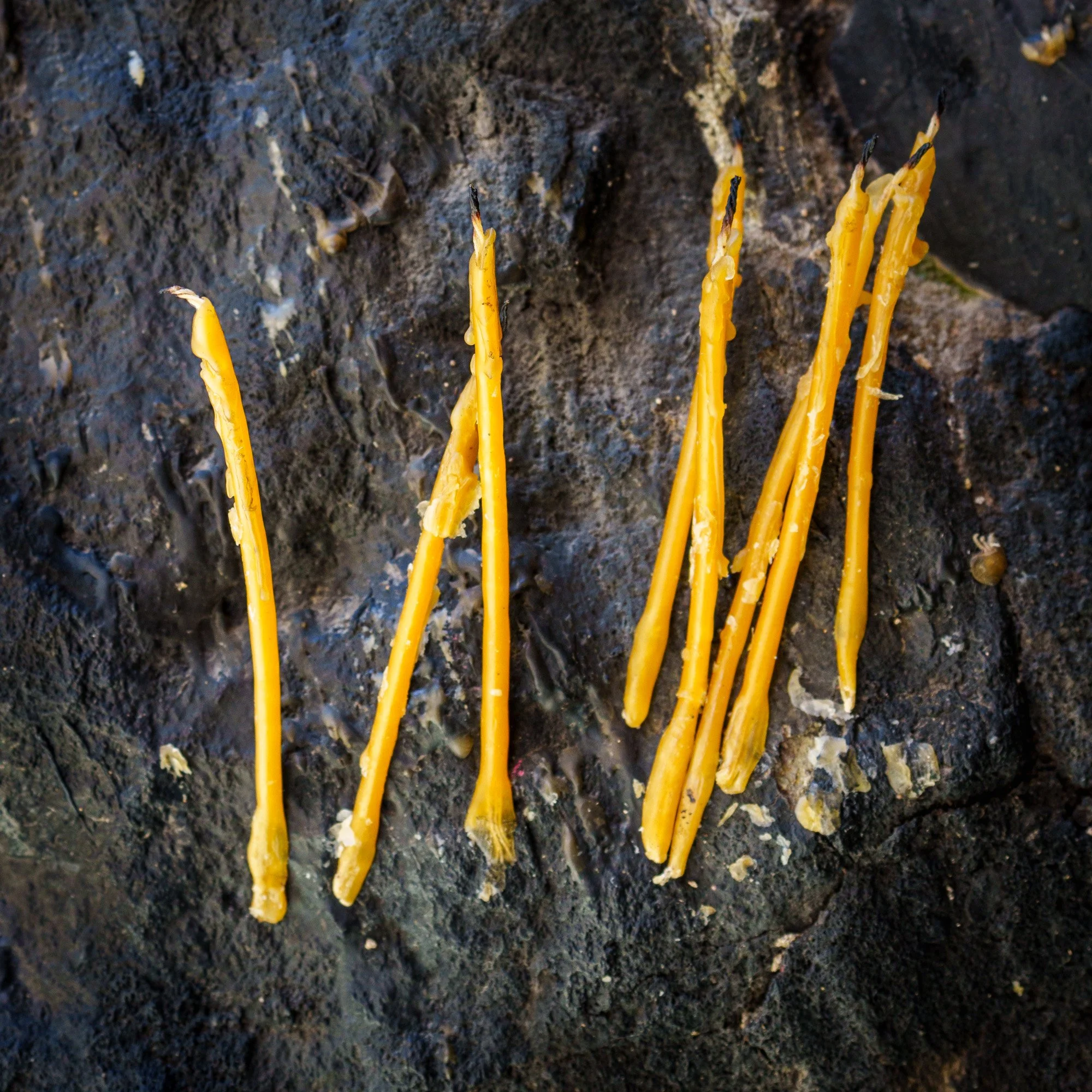West-östlicher Divan. Eine Spurensuche.
Goethes „West-östlicher Divan“ lag in meiner Hand und ich war fasziniert von diesem „anderen Goethe“. So las ich darin. Das war im Krankenhaus, nachdem ich mir bei einem Endurorennen mal wieder etwas gebrochen hatte. Bevor ich es zu Ende gelesen hatte, wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen und habe das Buch der Hospizstation überlassen. Vielleicht würde es dort etwas Trost bringen. Damals war auch der Wunsch geweckt worden, das Buch, auf das sich Goethe im „West-östlichen Divan“ bezieht, zu entdecken: Hafis‘ „Divan“ aus Persien, geschrieben im 13. Jahrhundert. Der Inhalt dieser beiden Bücher, die ich nie zu Ende gelesen habe, ist hier nicht der Grund, warum ich sie erwähne. Was sie in mir weckten, war die Neugierde, warum Goethe aus Hafis „geantwortet“ hatte. Zu Goethes Zeiten war der Orient eine geheimnisvolle Welt und inspirierte Künstler wie Mozart mit seiner „Entführung aus dem Serail“. Schon lange hegte ich den Wunsch, die Seidenstraße zu entdecken. Diese Büchen verstärkten meinen Drang, den Orient kennenzulernen. Ein Weiteres dazu tat das Magazin des Le Monde vom Ende 2023, dass sich mit der Wiege unserer Kultur befasste: Mesopotamien!
Von meinem ursprünglichen Plan, über die Türkei und Iran bis nach Kirgistan zu reisen nahm ich aufgrund der geopolitischen Lage (Überfall der Palästinenser auf Israel und dem darauffolgenden Krieg im Gaza-Streifen) bedauerlicherweise - Abstand. So fuhr ich mit meinem Motorrad über den Balkan und die Türkei „nur“ bis nach Georgien und Armenien, die ältesten noch bestehenden christlichen Kulturen.
Somit ist diese Reise nicht abgeschlossen, sondern es ist nur eine Etappe auf dem Weg der Kulturen.
Ich werde hier eine Art Reisetagebuch veröffentlichen und würde mich über Eure Gedanken dazu freuen!
Im Vorfeld habe ich mich mit Fachleuten zu den Religionen, denen ich begegnen werde, über meine Reise und mein Vorhaben unterhalten. So konnte ich den evangelischen und katholischen Pfarrer unserer Gemeinde Büchenbach, sowie den Vorsitzenden und den Imam der Moschee von Schwabach, den Rabbiner von Fürth und zu guter Letzt den Landtagsabgeordneten aus Schwabach, Herrn Freller, sprechen. Das Interesse war da und auch der Wunsch, dass ich im Anschluss an meine Reise über meine Erfahrungen berichte. Für mich waren diese Gespräche wichtig, da sie mir Einblick in die Religionen, die Menschen in einigen der von mir bereisten Länder und die persönlichen Ansichten meiner Gesprächspartner gaben.
Reisetagebuch Divan.
Das Tagebuch ist in der dritten Person Präsens geschrieben, um etwas Distanz zum Reisenden zu erhalten und es aus der Sicht eines Beobachters zu erfahren. Die Tagebucheinträge werden Tag für Tag ergänzt, sofern fertig. Also öfters mal reinschauen, um Neues zu entdecken!
Auf dem Weg der Kulturen.
Das ist der Start seiner bisher längsten Reise, die ihn bis nach Georgien und Armenien führt. Nur. Sein ursprüngliches Ziel was Kirgistan. Die chinesische Grenze; darüber hinaus ist es zu kompliziert und zu teuer. 2020 war es das Ziel. Alles war organisiert. Dann kam die Firma und wollte ein neues Medikament launchen. Zusätzlich kam Corona und der Plan war in der Schublade. Nun soll es 2024 sein, allerdings nur die halbe Reise. Nach einem Gespräch mit einer iranischen Reiseleiterin, die nach Deutschland geheiratet hat und Hélènes kommenden 60ten Geburtstag, den sie während einer Reise in die Mongolei feiern wollten, hat R. Georgien und Armenien als Ziel neu definiert. Sein Vorschlag, dass er Hélène in der Mongolei trifft (mit dem Motorrad!), wurde abschlägig beschieden.
Die Karte zeigt die schlussendlich gefahrene Route: dreieinhalb Monate, 15 Länder und 17.700.
Kurz bevor es losgeht.
R. hat seine BMW R1200GS an den Tagen vor der Abreise geputzt, sämtliche Funktionen überprüft und das Garmin Navi auf den neuesten Stand gebracht und beim TÜV noch die Vignette für Österreich gekauft. Die Koffer sind gepackt, wie immer zu voll. Die Frage ist nicht, was mit muss, sondern was nicht. Das Motorrad wiegt ohne Gepäck und Koffer 250 kg, mit Gepäck 300kg. Neben der Zeltausrüstung im linken Koffer befinden sich die Kochutensilien und die gesamte Fotoausrüstung rechts. Im Topcase sind die Klamotten. Die Regensachen sind im Rucksack auf dem Soziussitz verstaut. Im Tankrucksack ist die Kamera und allerlei Krimskrams. Geld und Kopien der Papiere sind gleichmäßig über die Koffer verteilt. Sicher ist sicher.
Tag 1; Mittwoch, 3. April 2024; Melk (Österreich); 400km
Die Abfahrt ist für R. eigentlich unspektakulär. Auf’s Moped setzen und losfahren. Diesmal filmt H. die Abfahrt. Und da es beim ersten Mal nicht so recht gelang, dreht R. am Ende der Straße noch mal um und ein zweites Video wurde gedreht.
Bis Passau geht es über die Autobahn und danach auf der Landstraße nach Melk, trotz Vignette. Es soll nicht zu schnell gehen. Fahren ist auch „Erfahren“. Auch wenn R. schon öfters die Strecke gefahren ist, so will er es diesmal „erfahren“. Langsam, schauen, wahrnehmen, verstehen. In Melk waren R. und H. schon. Ein Test für H. Ging schon einigermaßen gut. War aber für lange Zeit das letzte Mal. Bis letztes Jahr, da fuhren sie für 10 Tage nach Tschechien, Polen und in die Slowakei. Melk, kleine, einfache, in die Tage gekommene Pension „Zum weißen Lamm“; kein WLAN-Empfang im Zimmer; Fernseher geht auch nicht. R. besucht am späten Nachmittag das Stift. Immense Anlage; für Österreichs Monarchie wichtig gewesen. Ein Zentrum des Katholizismus. Staat und Kirche waren beinahe Eins, brauchten sich gegenseitig, um ihre Macht zu festigen. Heute lernen hier 900 Schüler einer Privatschule mit Internat, was sie für ihr künftiges Leben brauchen, vielleicht auch mehr. Die Bibliothek ist eindrucksvoll und zeugt von der früheren Macht des Stifts. Im Gartenpavillon findet R. zahlreiche Fresken, die die damals bekannte Welt idyllisch/verklärt darstellen. Szenen aus den im 18. Jahrhundert bekannten Kontinenten Europa, Asien, Afrika, Amerika. Szenen eines friedlichen Nebeneinanders von Kolonialisten und einheimischer Bevölkerung. Ein Wunschbild des Friedens, den es nie gab und die Kolonialisten als Gutmenschen da. Zeugt aber auch von der Faszination der Mächtigen für das Exotische.
Ansonsten ist in der Melker Altstadt nichts los.
Tag 2; Donnerstag, 4. April 2024; Zagreb (Kroatien); 450km
Nach dem Frühstück fährt R. über Eisenerz, Maribor, Celje und das Sava Tal nach Zagreb. Zufällig kommt R. am Tagebau in Eisenerz vorbei, wo das Redbull-Erzbergrodeo stattfindet. Man muss schon verrückt oder sehr gut sein, um daran teilzunehmen. Mittagspause in einer kleinen Arbeiterwirtschaft bei Leberknödelsuppe. War gut. Kurzes Gespräch über die Reise und Mopeds mit dem Wirt. R. genießt die gesamte Fahrt durch die hügeligen Landschaften. Seine Hüfte mag keine langen Fahrten. Zwischendurch aufstehen oder Pausen machen. Im Sava-Tag eine Pause. Die offenen Scheunen hier scheinen eine Eigenart der Gegend zu sein.
Zagreb kennt R. schon, hat es auf der Rückreise seiner ersten Balkanreise besucht und dort übernachtet. Lebendige, junge Stadt. Im Sommer. Chaotisches Hostel mit Schlafsaal am Stadtrand, aber mit Straßenbahnanschluss. Abends mit der kurzen und steilen Kabelbahn in die Oberstadt, der eigentlichen Altstadt. Viele Museen und Sehenswürdigkeiten sind wegen des zerstörerischen Erdbebens von 2021 noch immer geschlossen. R. geht wieder in das „Museum of broken relationships“ und schmunzelt über die Geschichten und Ausstellungsstücke.
Kebab zum Abendessen. Der Balkan beginnt hier.
Tag 3; Freitag, 5. April 2024; Zagreb
R. plant immer mindestens zwei Übernachtungen pro Etappe, um die Orte und Menschen besser spüren, sie besser verstehen zu können.
Frühstück gibt es in der Bäckerei neben dem Hostel und sein Weg führt in erstmal zum größten Friedhof des Landes. Ihn interessiert die lange, alte, mit einem Arkadengang versehene Friedhofmauer. Auch hier sieht R. die Schäden des Erdbebens. Alles gesperrt. Fotos nur durch den Zaun. Trotzdem beeindruckend. Anderen Touristen geht es genauso. Also durch die Gräberreihen schlendern. Gräber, die auf den Steinen sowohl das Kreuz als auch den Davidstern oder hebräische Schriftzeihen haben. Einmalig? Bedeutung? Leider kann R. nicht herausfinden, was es mit diesen Gräbern auf sich hat.
Zurück in die Innenstadt, zum Markt, der auf zwei Etagen Platz findet. Oben Obst, Blumen und Gemüse, unten mehr Fleisch. In einem Gebäude am Rand des Marktes befindet sich die große Fischhalle. Es ist feucht und der Boden nass vom geschmolzenen Eis. Viele Menschen hier. Gedränge in den den engen Reihen. Es ist laut und schön. Stehenbleiben, anschauen, beobachten. Die Menschen kennen sich, sie reden miteinander, lachen. Nur ein Foto gemacht. Draußen rot-weiße Sonnenschirme. Es ist warm. Das Angebot ist riesig. R. kauft Reiseproviant: getrocknete Feigen. Mehr nicht, die Versuchung groß ist, wie das Angebot an den Ständen. Unter den Arkaden der angrenzenden Gebäude sitzen Menschen, trinken Kaffee, Bier, Wein, unterhalten sich oder lesen Zeitung. Man kennt sich, grüßt sich, scherzt übereinander. Manche sind zum Trinken da, trinken viel und bleiben lange. Meist ältere Männer. R. streift über den Markt, um Fotos zu machen. Nach einer wenig erfolgreichen Runde setzt er sich wieder ins Café und bestellt einen doppelten Espresso. Auf Englisch. Ein älterer Herr von Nachbartisch wendet sich an R. und fragt, warum er denn auf Englisch bestelle? Hier verstünde doch fast jeder Deutsch! R. fühlt sich ertappt und blickt den Mann fragend an. Miroslav, so heißt der Alte, hat in Wien gearbeitet. Sein Eindruck ist, dass Deutsche ihre Sprache nicht mögen. Sie sprechen im Ausland immer Englisch, ohne es vorher in ihrer Sprache zu versuchen. Das versteht er nicht. Miroslav kennt die Deutsche Geografie fast besser als R. Sie sprechem über viele Ort und als R. sagt, wo er wohnt, erwähnt Miroslav die S-Bahn von N. nach RH! Auch R.s Geburtsort ist ihm nicht fremd. Obwohl Miro Deutschland nicht bereist hat, ist ihm das Land nicht fremd. Erstaunlich. Vielleicht kommt er im Herbst mal nach N. Sie tauschen Telefonnummern aus. Sie verabschieden sich voneinander. R. nimmt sich vor, ab jetzt erst auf Deutsch zu sprechen, dann auf Französisch und schließlich auf Englisch. Im Untergeschoss des Marktes gibt es einen Fischimbiss und R. wählt Calamari mit Pommes Frites. Der Herr vom Nachbartisch in Begleitung einer Dame empfiehlt ihm Weißwein dazu. R. winkt ab und bestellt Wasser. Wieder oben, findet er erneut einen Platz im ansonsten vollbesetzten Café unter den Arkaden und bestellt Kaffee. Auf Deutsch. R. freut sich, dass es funktioniert. Mittlerweile wird das Lokal von gut einem Dutzend alten Männern bevölkert, manche mit Hunden. Des abitués. Sie trinken Bier, zu viel Bier. Warum er kein Bier tränke, fragt ihn ein Mann? Zu früh, erwidert R.. Der Mann bestellt R. ein Bier. R. bedankt sich und prostet ihm zu. Trinkt aber nur sporadisch. R. beobachtet die Gäste, Beziehungen zwischen ihnen und auch dem Wirt werden deutlich. Wer kennt wen, wer kann mit wem, wer nicht, wer möchte alleine bleiben. Ein Mann trinkt nur Kaffee und liest Zeitung. Trotzdem ein Stammgast. Aber er ist nicht wie die anderen. Besser gebildet, mehr auf sein Äußeres bedacht, hat vielleicht auch mehr Geld, auf jeden Fall stellt er mehr dar. Ein alter Mann kommt mit einer großen Lidl-Tüte. Der Wirt geht in die Schenke und holt leere Flaschen, die er in den Sack des alten Mannes packt. Der bedankt sich und geht. Am Tisch nebenan schaut ein Mann nicht richtig hin, als er seine Zigarettenasche loswerden will. Sie fällt vom Raucher unbemerkt in sein Wasserglas, aus dem er anschließend einen Schluck nimmt. Als der Spender des Bieres die Terrasse verlässt, geht auch R. Lässt das angebrochene Getränk stehen.
Einem der bekanntesten Söhne Kroatiens wurde in Zagreb ein Museum erbaut: Nikola Tesla. Zu Recht! R. Macht eine Führung mit Live-Vorstellungen mit. Spannend ist die Hochspannungstechnik. Besucher melden sich für die Versuche freiwillig. Es knallt und man ist erstaunt über die Gewalt der Energie.
Abends an der Unterkunft kam ein Kontrolleur und sagte ihm, wie er seine Parkgebühr bezahlen könne. An bestimmten Kiosken gibt es die Möglichkeit, Parkzettel elektronisch zu lösen. 8€/Tag. Das kann man auch noch 24 Stunden nachträglich machen. Hat man keinen Kontrollzettel am Fahrzeug, muss man auch nicht zum Kiosk…
R. holt sich zum Abendessen einen Salat to go und isst ihn in einem Park. Es ist schon dunkel. Er geht in den nahen Bacchus-Jazzclub und genehmigt sich dort im Garten noch einen Drink. Drinnen ist die Luft vom Rauch zu stickig, wie in den 80ern, denkt sich R.
Kroatien hat nun auch den Euro. R. wird seine Kuna nicht mehr los. Das geht nur noch bei der Zentralbank, die am Wochenende aber geschlossen hat.









Tag 4; Samstag, 6. April 2024; Banja Luka; 350km.
Aus der Stadt heraus ist der Verkehr zäh. Langweilige Vororte ziehen sich an der Straße entlang und wollen kein Ende nehmen. Die Polizei weiß wohl, dass man gewillt ist, das Limit zu überschreiten und ist daher sehr präsent.
Weit hinter Karlovac gibt der Fluss Korana ein einzigartiges Schauspiel: breite, verzweigte Wasserfälle, oberhalb derer eine Reihe von Mühlen stehen. Beliebtes Ausflugsziel.
Auch wenn etwas später die Plitvicer Seen eine gute Gelegenheit für eine längere Pause wären, fährt R. weiter. Ein anderes Mal wird es diese berühmte Seenlandschaft besuchen. Mit mehr Zeit.
Die Abfertigung an der nahen bosnischen Grenze verlangt etwas Zeit, stellt sich aber als problemlos dar. R. genießt während der Weiterfahrt die Landschaft. Karstige Hochebenen und Wälder.
Die Unterkunft in Banja Luka befindet sich etwas außerhalb der Stadt, an einem Fluss gelegen. Abends spaziert R. in die Stadt und gewinnt einen ersten Eindruck von der Stadt. Einst katholisch, orthodox und muslimisch. Heute Hauptstadt der Republika Srpska innerhalb von BiH. Alt, neu, lebhaft, gemütlich. In einer Kneipe trägt eine Sängerin lokale und internationale Schlager vor. Der Abend klingt ruhig aus.
Tag 5; Sonntag, 7. April 2024; Banja Luka
Es ist versalzen. Das Omelett ist total versalzen. Schade.
Am Fluss Vrbas entlang schlendert R. in die Stadt. Auf dem Weg sieht er alte Frauen, die Gemüse am Straßenrand verkaufen. Einige Kaufwillige halten an, unterhalten sich, packen Obst und Gemüse in Tüten, reden mit anderen alten, gehen ihres Weges. Vorbei an einer neu wirkenden orthodoxen Kirche setzt R. sich gegenüber einer Moschee in ein Café und trinkt bosnischen Kaffee. Könnte auch türkischer Kaffee sein oder griechischer. Kaffee ist ein nationales Gut und muss auch so behandelt werden. R. erinnert sich an die „freedom fries“ als Amerikas Antwort auf eine Auseinandersetzung mit Frankreich, die bekanntermaßen nicht die Erfinder der „french fries“ sind…
Nationalismus selbst auf dem Teller und in der Kaffeetasse.
Vor R. taucht die erste Moschee in diesem zerrissenen Land, das muslimisch und christlich ist, aber das der Konflikt mit den serbischen Machthabern in zwei geteilt hat, auf. UNO hat versagt. NATO hat versagt. EU hat versagt. Politik hat versagt.
Auch hier lebt die Hagia Sofia des alten Konstantinopel weiter. Ihre Formen sind die Matrize für die meisten Moscheen geworden. Im Innern hoch und hell, mit weiten Räumen, hohen Kuppeln und mächtigen Leuchtern. Ihr Inneres strahlt Ruhe und Erhabenheit aus. Ein Ort der Stille und Andacht. Reste der alten Moschee wurden 1993 in die Luft gejagt. Banja Luka ist christlich orthodox, ist Regierungssitz der Republika Srpska in Bosnien. Der Krieg hat nur wenig Spuren hinterlassen. Bosnische Serben jedoch sprengten viele römisch-katholische und muslimische Gotteshäuser. Katholiken und Moslems haben größtenteils die Stadt verlassen. Im Gegenzug kamen viele serbische Bosnier aus anderen Gebieten hierher. Ein gespaltenes Land. R. fragt sich, wie dieses Land mit dem Zwiespalt leben kann.
Im Park spielen alte Männer mit großen Figuren Schach. Kommentiert von anderen alten Männern. Die Spieler wechseln nach einer Partie und der Verlierer gibt dem Sieger ein Geldstück.
Auf dem großen Platz machen laufen Kinder wild umher, die Elter sitzen auf den Parkbänken und genießen die Sonne. Ein Mann im Rollstuhl verkauft mit Gas gefüllte Luftballons, die von Wind hin und her geweht werden. Er hat sie an einem mit Sand gefüllte Kanister befestigt, auf dem ein Behindertensymbol prangt.
R. besucht die orthodoxe Erlöser-Kirche neben dem Park, die nach Beendigung des Jugoslawien-Kriegs wieder originalgetreu aufgebaut wurde. Zerstört war sie schon lange, seit dem zweiten Weltkrieg. Wieder Prunkvoll, komplett ausgemalt. Ein Bilderbuch des Christentums, das zu verstehen R. nicht in der Lage ist. Ihm fehlt der religiöse Hintergrund.
Etwas weiter aus dem Zentrum heraus befindet sich die katholische Kathedrale. Ein erstaunlicher Bau. Beton-jugoslawisch-sozialistisch! Der Kirchturm erinnert an einen Flughafentower und das Kirchengebäude an eine Lagerhalle mit Fahrstuhl. Davor breitet Jesus seine Arme aus, bricht mit der Architektur der Kirche. R. kommt nicht rein, geschlossen, kein wahrer Blick ins Innere möglich. Er macht einige Aufnahmen der sonderlichen Architektur, an der deutlich der Zahn der Zeit nagt.
In einer Seitenstraße neben der Kathedrale findet ein Gottesdienst in der orthodoxen Dreifaltigkeitskirche statt. Wohl eine Taufe. Viele schicke Leute kommen aus der Kirche. Der Raum für die Opferkerzen ist groß, nur wenige Kerzen brennen.
Die Gebäude in den Straßen sind eine Mischung aus verschiedenen Epochen, meist nach dem zweiten Weltkrieg gebaut. Banja Luka hat sehr unter den Folgen des großen Erdbebens von 1969 gelitten. Das sieht man noch heute. Im Stadtbild lenkt eine alte Reklame auf einer Hausfassade die Aufmerksamkeit auch sich. Reste des Emblems der „Yugoslav Travel Agency“ sind noch zu sehen. Der Name ist fast verschwunden. Vergangenheit.
Beim Abendessen in einem Lokal am Fluss fragt R. die junge Bedienung, ein Mann, wie er das Verhältnis zwischen Christen (serbische Bosnier) und Moslems (Bosniaken) sieht. Er als Christ hat auch muslimische Bekannte und Freunde, mit denen er ausgeht. Vielleicht lag es am gebrochenen Englisch, dass seine Worte wenig überzeugend klangen.









Tag 6; Montag, 8. April; Srebrenica; 280 km.
Die Schönheit des Vrbanja-Tals täuscht über die politischen und gesellschaftlichen Spannungen im quasi-zweigeteilten Bosnien hinweg. Pause in Kalesija. Börek gegenüber dem Mahnmal für die Opfer des Kriegs. Mitten in der Stadt. Vor dem Rathaus. Für jeden sichtbar, immer. Hoffentlich nicht nur Trauer, sondern auch Abschreckung. Aufforderung zum Dialog?
An der anmutigen Driva entlang fährt R. nach Srebrenica, Ort des Grauens. Hier trifft alles Undenkliche der menschlichen Natur aufeinander: Hass bis zum Massenmord, nationalistischer Wahn auf der einen Seite, Vertrauen auf Hilfe auf der anderen Seite und Versagen durch mangelnden Mut und Desinteresse der internationalen Truppe. 8.000 Tote, hingerichtet vor den Augen der Welt. Mit Ansage!
Auf einer an einem Haus angebrachten Plakette wird der serbischen Opfer des muslimischen Terrors in der Gegend gedacht. Verkehrung der Realität. Blinder Nationalismus. Hohn. Hier ist auch die Republika Srpska!
Srebrenica liegt eigentlich idyllisch in einem engen Tal. Ein kleiner Ort. Die Gebäude stammen meist noch aus der sozialistischen Zeit. Sind heruntergekommen. Spuren des Krieges überall. Menschen, Familien sitzen zwischen halb verfallenen Häusern und grillen oder unterhalten sich. Auf einem kleinen Platz im Zentrum, ein neuer Brunnen mit einer Weltkugel, von einer aus dem Brunnen kommenden Hand gehalten und auf der Kinder im Reigen tanzen, fährt ein Junge einsam mit seinem Fahrrad. Immer um den Brunnen herum. Alleine. R. hat ein beklemmendes Gefühl. Er hat den Eindruck, dass die Menschen hier keinen Antrieb haben, den Ort wieder aufzubauen. Sie lassen es geschehen, was auch immer. Trostlos und sterbend. Nach dem Massaker an den Bosniaken schein die hiesige serbische Bevölkerung kein Ziel, keinen Wunsch nach Verbesserung, zu haben.
Es gibt keine echten Touristen. Einige wenige Menschen kommen her. So wie R. Allein oder in kleinen Gruppen. Fallen sofort auf. R. fühlt sich nicht willkommen. Was wollen Touristen hier? Was will R. hier? Hier gibt es nichts Besonderes. Keine Infrastruktur. Essen gehen. Wo? Nur kleine, notdürftig eingerichtete Ess-Räume. Er geht in so einen. Bestellt Suppe und sonst noch was. Kostet fast nichts, schmeckt gut. So muss es bei uns in der Nachkriegszeit gewesen sein.
Tag 7; Dienstag, 9. April 2024; Srebrenica; Fahrt nach Sarajevo, 150km.
Kein Frühstück. Ins Hauptquartier der UN-Truppen vor der Stadt. Eine alte Batteriefabrikhalle. Hier lief alles falsch. Keine Unterstützung für die nur schlecht ausgestatteten niederländischen Truppen, Entwaffnung der nur leicht bewaffneten Bosniaken, nicht der gut ausgerüsteten Serben (!), überfüllte Lager und das Vertrauen der bosnischen Flüchtlinge in die Schutzzusagen der UN. Trotz Warnungen durch die Bosniaken, dass die Serbien sie töten werden (Erfahrung aus anderen Regionen…), haben die UN-Truppen der Deportation, getrennt nach Männern/Jungen (--> Hinrichtung) und Frauen, zugestimmt und auch noch Transportmittel zur Verfügung gestellt. Erst sehr viel später wurde ihnen der Prozess gemacht.
In der Fabrik ist fast alles noch so, wie 1995, als das Massaker stattfand. Büromöbel, Unterkünfte, Lagebesprechungsraum. In der großen Halle eine ausführliche Darstellung der Ereignisse vor, während und nach dem Massaker. Besonders beklemmend sind für R. die Filme: Augenzeugenberichte und solche der Täter. Auf einer langen Glasplatte sind Schuhe zu sehen, Schuhe der Flüchtenden, Schuhe der Opfer.
R. spricht mit einer Mitarbeiterin der Dokumentationsstelle. Junge Muslima mit Kopftuch. Sie spricht Englisch. Sie kommen auf die quasi Zweiteilung des Landes in bosniakische=muslimische Gebiete (Föderation Bosnien) und solche mit einer serbischen=christlich-orthodoxen Bevölkerung (Republika Srpska) zu sprechen. Beide Gebiete sind praktisch gleichgroß, was zeigt, das Serbien damals sein Ziel größtenteils erreicht hat. Die serbische Teilrepublik wird autonom verwaltet und nach Meinung der jungen Mitarbeiterin streben die bosnischen Serben weiterhin eine Zugehörigkeit zur Republik Serbien an. Die Republik Serbien, die Republika Srpska und Russland haben die gleichen Flaggenfarben mit dem Unterschied, dass die Russische spiegelbildlich zu den beiden anderen ist. Hier sieht man die politische Ausrichtung, nicht erst seit dem Krieg. R. äußerst gegenüber der jungen Dame seine Zweifel hinsichtlich der Stabilität des Landes. Die Mitarbeiterin selbst glaubt nicht an einen EU-Beitritt, hofft aber auf eine NATO-Mitgliedschaft. Eine Annäherung an die EU und die NATO könnte die Situation eskalieren lassen und Russland auf den Plan bringen, erwidert R. Eine Situation wie in den 90er Jahren hält sie nicht mehr für möglich. Inschallah geht es R. durch den Kopf. So Gott will oder die Machthaber.
Gegenüber der Dokumentationsstelle befindet sich der muslimische Friedhof, auf dem die Opfer des Massakers beigesetzt wurden. Noch immer gibt es neue Gräber von Opfern, die erst jetzt identifiziert werden konnten. Ein Meer von Marmorstelen. Soweit das Auge reicht. An manchen den Grabstelen haben Menschen Gebetsketten angebracht. Bedrückend. Real. Beim Gang durch die Gräberreihen fragt sich R., wie es dazu kommen kann, dass Menschen zu Bestien werden. Blinder Nationalismus, gepaart mit selbstherrlichen Führungsfiguren, die dem Mob einfache Botschaften senden: Das sind die Schuldigen für Eure schlechte Lage. Tut dies und tut das. Dann geht es Euch gut und Ihr seid Helden. Milosevic wollte in den 90ern nicht die serbische Hegemonie über die anderen jugoslawischen Teilrepubliken verlieren. Nach Titos Tod wuchs der Nationalismus und endete im Anschluss an den Untergang des Sowjetischen Imperiums im jugoslawischen Bürgerkriegs-Chaos. Autokraten, Diktatoren und Demagogen haben auch aktuell Konjunktur: Trump (Make Amerika great again) Putin (Panslawischer Führer), Orban (ungarische Herrlichkeit und Selbstgefälligkeit), Erdogan (Führer aller Moslems), Fundamentalisten (islamische und andere), AFD, FPÖ und so weiter. Nur selten gelingt es, sie aufzuhalten (die Kaczynskis in Polen). Ein Weg zurück ist dann immer schwierig. Menschen in Horden haben keinen individuellen Verstand, nur kollektive Emotionen, meist primitive.
R. steigt auf sein Motorrad und fährt nach Sarajevo. Kleine Straßen durch Berge und tiefe, feuchte Täler, durch dichte Wälder. Nur dort, wo auch Spuren sind. Minen gibt es dort in den Wäldern noch. Weit kommt R. nicht. Die Wege werden schlammig, steinig, unpassierbar, verschwinden. Wie die Menschen, damals. Umdrehen und richtige Straßen suchen.
Sarajewo, die Widerspenstige, die sich verteidigende, die Überlebende.
Heute ist der letzte Tag des Ramadan, das Fastenbrechen wird freudig, sehnsüchtige erwartet. 19h29, ein lauter Knall. Er ist nur die Feuerwerksrakete, die das Ende des Fastens verkündet. In Hof der Moschee werden Datteln und Wasser gereicht. Ein junger Mann bringt R. Datteln. Er spricht Deutsch, da er Familie in Düsseldorf hat. Sie kommen ins Gespräch, über R.s Projekt. Religion sieht man dem Menschen meist nicht an, sagt der junge Mann zu R. Männern zumindest nicht, auch nicht hier in Bosnien. Kinder spielen auf dem gepflasterten Vorplatz der Moschee, springen umher, spielen fangen, fahren Rad.
R. geht dann weiter. Sieht sich in der Stadt um und geht in ein Lokal mit reichhaltigem Fasten(brechen)essen: Datteln, Salat mit Tomaten, Gurke, Kohl, Fladenbrot mit Käsesoße, Hühnersuppe, Gegrilltes vom Kalb mit Pommes, Honiggebäck. Dazu Limonade und Kaffee.
R. genießt das rege Treiben, Menschen, die fröhlich und lachend durch die engen Gassen der renovierten Altstadt mit ihren vielen Buden gehen. Meist in Gruppen oder als Familie.
Zurück zum Franz-Ferdinand, R.s Hostel. Humor muss der Besitzer haben, diesen Namen zu verwenden!
Tag 8; Mittwoch, 10. April 2024; Sarajevo
Die Menschen haben sich fein gemacht. Schicke Kleidung, traditionell. Alle Geschäfte haben geschlossen. Der Tag nach dem Ramadan (hier Ramazan) ist ein Feiertag. Nun gut, also den Tag genießen und beobachten. Eine Gruppe Männer in Trachten geht über den großen Platz zwischen Moschee und ehemaligen Basar: schwarze, weit geschnittene Hosen und eine ärmellose, schwarze Weste über einem weißem, tief eingeschnittenem Hemd, rote Kappe, ein um die Hüfte gewickeltes, langes Tuch aus orange-gemustertem Stoff. Ein willkommenes Fotomotiv! Wenig später trifft R. auf einen Mann mit stattlichem, schwarzem Vollbart, weißem Turban, langem weißen Gewand und darüber ein knöchellanger schwarzer Umhang mit gold-bestickter Borte. Wohl ein muslimscher Geistlicher.
Aus einer Einkaufsstraße mit ihren geschlossenen Geschäften schallt Musik herüber. Eine Brass-Band mit Trompete, Trommel und drei Tuba. R. wirft einen Geldschein zu den anderen in den vor ihnen liegenden, gelben Karton, lauscht noch ein wenig und geht weiter.
Auf dem Boden vor ihm erscheint im Straßenpflaster eine große Kompassnadel, die nach Ost und West zeigt; Nord und Süd sind durch einen Schriftzug markiert: „Sarajevo Meeting of Cultures“. Kulturen, die sich voreinander entfernt haben, denkt R. In einer alten Karawanserei, die neben einem Café einen iranischen Teppichhändler beherbergt, trinkt R. einen Kaffee, ruht sich aus, beobachtet eine Familie: Mann, Frau, Kind in der Karre, die ein Erinnerungsfoto machen. Heile Welt. Es gab hier mal sechs Karawansereien. Die anderen sind verfallen oder nicht mehr existent. In Belgrad, sagte R. jemand, gab es 80 Moscheen. Vor dem Krieg. Danach nur noch eine aktive.
Am Nachmittag schließt R. sich einer Führung auf Deutsch an. Der Stadtführer ist Bosniake. Er hat die meiste Zeit in Deutschland gelebt, in Stuttgart, schwäbelt sogar ein wenig. Für ihn ist Sarajewo etwas Besonderes: viele Gruppen leben hier friedlich zusammen und achten aufeinander: muslimische Bosnier, orthodoxe Serben, katholische Kroaten, sephardische Juden. Inschallah, so Gott will. 80% der heutigen Bevölkerung sind jedoch Muslime; die anderen Bevölkerungsgruppen haben zu Beginn des Krieges die Stadt verlassen. Nur wenige kamen danach zurück.
Es ist auch die Stadt, die den ersten Weltkrieg durch das Attentat auf Franz-Ferdinand auslöste. Der Thronfolger hätte nur auf seine Ratgeber hören müssen und wäre dann dem (nicht unerwartetem) Attentat entgangen…
Ein Pärchen sieht R. mit seiner Kamera und bittet den Fotografen, sie mit ihrem Handy zu fotografieren. R. lächelt und freut sich über diese Anerkennung.
Gegen Abend geht eine die Außenmauern der Moschee umspannende Lichterkette an. Wie Regentropfen hängen grüne Leuchtdioden daran und werden von einer alles überragenden gold-gelben Mondsichel, an dessen oberem Ende ein großer Stern prangt, überragt.
Tag 9; Donnerstag, 11. April 2024; Sarajevo
R. sucht das Portemonnaie, mal wieder verlegt, leichte Panik. Nach langem Suchen findet er es in der Motorradjacke. Vergessen, herauszunehmen. Schlechte Angewohnheit.
Sarajevo ist schön. Wenig erinnert an den Krieg. Wenn man nicht aufmerksam ist. R. begegnet bei seinen Spaziergängen Mahnmalen im Boden. Löcher in der Straße, in denen kleine Granaten stecken. Um sie herum nachgestellte, tiefrote Blutflecken, die explosionsartig von dem kleinen Krater nach außen strahlen. Erinnerungen an eine blutige, sehr nahe Vergangenheit. Die meisten gehen daran vorbei. Manche bleiben stehen. Schauen entsetzt oder nachdenklich diese Reste des Mordens an. Meist Touristen. An Hauseinfahrten verkaufen ältere Menschen ein wenig Obst und Gemüse. Es sieht gut aus. Zu gut. Stammt wohl aus dem Großmarkt. Ab und zu bleibt ein Kunde stehen, schaut, sie reden vielleicht ein wenig und vielleicht kauft er etwas.
Der Weg führt R. heute früh zum jüdischen Museum. Die sephardischen Juden sind zahlreich aus Spanien und Portugal gekommen, als die katholischen Könige wieder die Macht über das verfallende Kalifat übernommen haben. Das osmanische Reich hat diese klugen und geschickten Leute gern genommen. Sie stellten eine Bereicherung für das Reich dar. Im jüdischen Museum begegnet R. einem Bewohner des Hostels und kommt mit ihm in Gespräch. Er ist sephardischer Jude aus Portugal. Erzählt, dass ein Teil seiner Familie damals über Thessaloniki bis nach Bosnien und hier nach Sarajevo ausgewandert ist. Im weiteren Verlauf des Gesprächs kommt die aktuelle Politik Netanjahus zum Gespräch und ob sein Vorgehen für Israel vorteilhaft ist, was R. anzweifelt. Der jüdische Gesprächspartner sieht das anders und betont, dass er zu Israel steht und seiner Politik. Bereits vor der Gründung des Staates Israel habe es Einwanderungsbewegungen gegeben. Diese Menschen gingen dort hin, um IHR Land wieder zu besiedeln. Sie hätten ein Anrecht darauf! R. erinnert sich, gelesen zu haben, dass Ende des 19. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die zionistische Bewegung Land im heutigen Israel für die Siedler gekauft hatte. Heutzutage besetzen israelische Siedler, meist ultrakonservative, das Land und verdrängen die Palästinenser. Das ist ein großer Konflikt in der Gegend. Der Gesprächspartner wünschte mir noch einen schönen Tag, meinte, ich solle meine Argumentation verbessern und bitte im Hostel sein Jüdischsein nicht Preis geben. Es gebe hier halt viele Moslems… Er ergänzte, dass man nationalistisch denken und zugleich tolerant sein könne. Nun, R. hat wieder etwas dazugelernt. Es gibt keine einfache Diskussion über Israel und das Jüdischsein.
Etwas verunsichert geht R. weiter zum Treffpunkt für die „Sarajevo War Tour“. Der Guide hat den Krieg als Jugendlicher in der Stadt miterlebt. Durch seine Erzählung wird die dramatische Situation real: wo bekomme ich etwas zu Essen her? Welchen Weg muss ich zur unterirdischen Schule nehmen, um den Snipers in den Sarajevo umgebenden Bergen zu entgehen? Der Weg führte mit einem Kleinbus auch zum Versorgungstunnel, der unter dem durch die UN-Truppen kontrollierten Flugplatz verlief und die Versorgung der Stadt mit Nahrung und Waffen sicherstellte. Die Serben konnten den Tunnel nie lokalisieren. Dort hindurchzugehen ist eine Erfahrung, die R. beklemmend empfindet. Niedrig, feucht, dunkel. Dann ging es in die umliegenden Berge und wir konnten sehen, von wo aus die Serben die Stadt beschossen haben. Sie liegt vor R. Füßen. Wie auf einem Präsentierteller. Noch bis kurz vor Beginn der Kampfhandlungen gingen Serben und Bosniaken gemeinsam in den Stadtvierteln Nachbarschaftsstreife. Wohl, um sich gegenseitig zu kontrollieren. Die Serben forderten dann die Bosniaken ultimativ auf, ihre Waffen niederzulegen. Die Nachbarschaftsstreife des Guides (die Elterngeneration…) sah darin ein Unheil (was es dann auch gewesen wäre, da die serbische Armee Sarajevo bereits eingekesselt hatte) und startete einen Überraschungsangriff auf die bewaffneten Serben. Dadurch wurde eine Zweiteilung der Stadt verhindert.
Letzte Station waren die Anlagen der olympischen Winterspiele 1984. Die Bob-Bahn ist spektakulär und komplett verfallen. Graffitis schmücken die Röhren. R. entdeckt zwischen den Bunten Bildern eine Friedenstaube. Flieg Vogel, flieg…
R. interessiert sich dafür, wie die verschiedenen Gruppen heute zusammenleben? „Geht so, könnte aber besser sein, würden die Serben ihr Unrecht und den Genozid zugeben.“ Laut serbischer Propaganda gab es „nur“ ungeplante Massaker, aber keinen Genozid. Tot sind die Menschen trotzdem, denkt sich R.. Das aktuelle politische System in BiH mit zwei Regierungen (Republika Srpska und Bosnische Föderation) verhindert jeden Fortschritt.
Zurück im Hostel denkt R. immer noch an die Worte des Guides. Er befragt die Rezeptionistin, wie sie die Situation erlebt hat. Sie ist österreichisch-serbische Protestantin. Ihre Freunde von damals kämpften als junge Männer gegeneinander. Erst im Nachhinein haben sie realisiert, wie dumm sie waren und wie einfach sie auf die Propaganda der Führungen hereingefallen sind.
Tag 10; Freitag, 12. April 2024; nach Mostar; 150km
Eigentlich freut sich R. an diesem Tag eine schöne Landpartie zu machen. Von Sarajevo ins Gebirge, über Hadzici nach Lukomir und weiter nach Glavaticeyo. Von dort durchs Gebirge nach Zijanlje. Die Wege sind anspruchsvoll, zum Schluss Schotter und bergauf. Zuviel für R. R. dreht um und nimmt die Asphaltstraße über Konjic nach Mostar.
Das Skigebiet bei Mostar ist teils noch aus der Zeit der Olympiade, teil neu. Eine Mischung, die spannend ist und jetzt, wo niemand Ski fährt, skurril. Neues neben Verfallendem. Bewaldete Täler im Frühjahrskleid ohne Blätter wechseln sich mit kahlen, noch braunen Bergrücken ab. Kleine, einsame Dörfer mit ihren alten, Blech bedeckten Häusern und unbefestigten Straßen säumen R.s Weg. Menschen sieht er nur vereinzelt, Vieh ist noch in den Ställen. Kalt ist es. Neue Häuser sind dazwischen, ohne Putz meist, halb fertig. Ein einsamer Wohncontainer steht auf einer Wiese kurz vor einem windigen Pass. Die Farbe bröckelt. Verwendung unklar. Die enge, oft mit Geröll und Schotter bedeckte Straße schlängelt sich durch die windgepeitschten Berge. Die wenigen Wolken ziehen rastlos über sie hinweg. Spartanische Schönheit. Nicht einladend. Jetzt nicht einladend. Im Sommer wohl für Wanderer und Jäger. R. hält auf einem geschotterten Parkplatz am Straßenrand an. Sein linker Fuß findet darauf keinen Halt. Rutscht langsam nach außen. Unaufhaltsam. Unhaltsam das Motorrad. Im Zeitlupentempo entgleitet es ihm und legt sich auf die linke Seite. 300kg. Zu viel. Es bleibt auf den Koffern liegen, bis LKW-Fahrer anhalten und R. helfen, es aufzustellen. Dank. Dank. Dank. Rücken schreit: „Kein Dank, Idiot!“. R. macht das Foto. Nicht vom liegenden Motorrad.
Konjic: Titos Bunker. Gerade Mittagspause im Bunker. Kann warten, der Bunker. Nächstes Mal.
Mostar kommt in Sicht. Es geht den Berg runter ins Tal. Mostar ist von hohen Bergen umgeben. Der klare Fluss trennt die Stadt in zwei Teile. Muslime und Christen. Die Spuren des Krieges sind noch allgegenwärtig. Die Brücke? Neu wieder aufgebaut. Für todesmutige Springer. Für Touristen. Für die Bevölkerung?
Miran ist der perfekte Gastgeber des Hotels. Beredt, hilfsbereit, kommertant. R. spaziert durch die Stadt, die er bereits zweimal besucht hat, allein und mit Max.
An einem großen Gebäude stehen Menschen und reden miteinander. Sie lachen. Es ist das Kulturzentrum der Stadt und es findet eine Veranstaltung statt. R. geht hinein. Es ist gratis. Setzt sich auch einen freien Platz. Plüschige, rote Sessel in einem großen Konzertsaal. Die Leute kennen sich, auch die Akteure (zu erkennen an ihren folkloristischen Kostümen). Tanz und Gesang wird dargeboten. Im Hintergrund auf der Leinwand laufen Videos mit Bildern der Stadt und der Umgebung. Man lacht, freut sich, grüßt und ruft sich gegenseitig zu. Zwischen den Darbietungen können die Kinder und Jugendlichen, die eben noch auf der Bühne standen, durch die Seiteneingänge in den Publikumsraum und gehen zu Freunden und Verwandten, unterhalten sich. Die Stimmung ist gut, locker, jovial.
Mit einem guten Gefühl geht R. zurück zum Hostel.
Tag 11; Samstag, 13. April; Mostar
Der Tag wird ruhig sein. Im Innenhof des Hostels findet R. einige Mitbewohner beim Frühstück am großen Tisch. Miran serviert alles, was die Gäste wünschen. Der Tisch ist voll. Platz ist wenig. Gespräche laufen von rechts nach links, von hinten nach vorne, quer über den Tisch. Auf Englisch oder mal in einer anderen Sprache. Die Leute kommen aus Georgien, Equador, Indien, Russland, Niederlande, Deutschland.
Es ist noch zu früh für Touristenbusse. Die Gassen mit den Verkaufsständen der Altstadt sind leer, die Buden noch zu. Vereinzelt Menschen. An der die Neretva überspannenden. Auf der nach der Zerstörung neu aufgebauten Brücke begegnet R. einer jungen Muslima. In ihr Gewand gehüllt verschwindet sie hinter dem Scheitelpunkt der Brücke. Im gleichen Augenblick erscheint von der anderen Seite der Brücke kommend eine junge, hübsche, in ein wallendes, blutrotes Kleid gehüllte Frau, begleitet von einem Videografen und einer „Regisseurin“. Man solle bitte aus dem Blickfeld gehen. Sie gehen hin und her, verschwinden über die Brücke auf die andere Seite, nicht mehr sichtbar, um dann wieder zurückzukommen. R. nutzt die Gunst des Moments und fotografiert das Model.
Die Stadt ist leer, viele Gebäude sind leer. Ruinen tragen die Male des Krieges, verlassen und allein gelassen. Einige Blumen erobern Mauerritzen und fensterlose Fenstersimse. Abseits der Brücke und ihren beidseits renovierten touristischen Gassen hat die Stadt das Trauma noch nicht überwunden. An einer Hauswand betrachtet R. die Spuren eines Granateinschlags, der mit Zement ausgefüllt wurde. Nur die feinen, streifenförmigen, vom Zentrum des Einschlags wie Sonnenstrahlen nach außen führenden Kratzer der Splitter sind im Mauerputz noch sichtbar.
Abends gibt es Fußball. Mostar gegen Mostar. HSK Zrinjski Mostar gegen FK Velez Mostar, weiß gegen rot, katholisch gegen muslimisch, 1:0. Enttäuschung in der Bar. R. schaute sich die Velez Fans aufmerksam an. Fans, wie anderswo auch. Sie bleiben ruhig, sitzen noch etwas zusammen und gehen dann ihrer Wege.
Am Abend kontrolliert R. sein Telefon. Die Magenta App zeigt Kosten von über 100€ an. Mit Erschrecken stellt R. fest, dass er nur einen Datenvertrag gebucht hat, aber keinen Telefontarif. R. beschließt, nur noh per WhatsApp zu telefonieren.
Tag 12; Sonntag, 14. April 2024, von Mostar nach Zabljak (Montenegro), 250km.
Mostar ist klein, von der Altstadt aus gesehen. R. verschafft sich einen Überblick über die gesamte Stadt. Nach vielen Serpentinen kommt er auf dem Berg der östlichen Seite der Neretva an. Eine weit in die Leere reichende, metallene Aussichtsplattform lädt zum Verweilen ein. Auf dem gegenüberliegenden Berg haben die Christen ein gigantisches, nachts blendend weiß beleuchtetes, weithin sichtbares Kreuz (Millenium Cross, 33m) aufgestellt. Jedem das Seine, ich hier, Du dort, kommt R. in den Sinn. Kein Zeichen der Versöhnung zwischen Christen (katholisch) und Muslimen. Unten breites sich vor R. die gesamte Stadt entlang dem Fluss aus. Ein Vielfaches der alten Stadt. Es geht weiter, nur ein paar Kilometer weit. Nach Blagaj und seinem aus den Karstbergen schießenden Fluss Buna. Es mutet wie ein Wunder an, eine riesige Hähle, einem gewaltigen Maul ähnelnd, lässt die Wassermassen aus dem Berg sprudeln. Direkt an dem Schlund befindet sich ein kleines Derwisch-Kloster. Der mystische Sufi-Orden hat hier an diesem magischen Ort eines ihrer spirituellen Zentren während des osmanischen Reichs aufgebaut. Er geht vorbei an unzähligen Lokalen, überquert die Buna an einer kleinen Brücke und gelangt fast bin an die „Quelle“. Schwalben jagen um den Eingang der Quelle herum, tauchen in die Dunkelheit ein und schießen einen Augenblick später mit Geschrei wieder heraus. R. ist fasziniert von diesem Schauspiel. Nach dem Besuch des Klosters trinkt er noch einen Kaffee und genießt den Anblick.
Auf kleinen Straßen soll es weitergehen, bis es auf die höher gelegene Hauptstraße geht. Die Asphaltstraße ist schmal und windet sich gegen den Talausgang zu. Sie verengt sich und Schotter mischt sich mit Asphalt, bis der Asphalt ganz verschwindet. Das Tal wird enger, ein Ziegenhirte hat hier seinen Hof und hütet in der Nähe seine Tiere. Die Straße wird zum Weg; es geht leicht bergauf. Die in der Flanke des Tals gelegene Straße zu der R. will, ist nicht weit. Der Weg schlängelt sich langsam nach oben, das Fahren wird schwierig, bis das Hinterrad den Grip verliert. Das Motorrad steht. Langsam anfahren. Es hilft nichts. Zwei, drei Gasstöße. Das Motorrad steht von alleine. Das Hinterrad ist bis zum Kardan eingegraben. Ende. Absteigen. R. versucht, das Motorrad zu bewegen. Nichts. Keinen Millimeter bewegt. Dabei den Tragegriff des Koffers abgerissen. R. denkt nach. Vor ein paar hundert Metern war der Hirte mit seinen Ziegen am Weg. Er macht sich auf, um den Hirten zu suchen. Nach ein paar Minuten findet er ihn und mit Händen und Füßen macht R. ihm klar, dass er seine Hilfe benötigt. Gemächlich gehen beide zum Motorrad. Der Hirte ist schon älter; das Gesicht gekennzeichnet vom Wetter, gegerbt, zerfurcht, dunkel, trotzdem freundlich. Zu zweit schuften sie, um das schwere Gerät um 180 Grad zu drehen. Beide sind erschöpft. R. gibt dem Hirten aus Dankbarkeit ein Trinkgeld. Die Rückfahrt über den schmalen Schotterweg bergab ist nicht einfach, mehrmals droht R. den Halt zu verlieren. Er schafft es. R. nimmt sich vor, keine Experimente zu machen, wenn Hilfe nicht erwartbar ist. Vorerst. Weiter nach Gacko und Foca durch tief eingeschnittene Täler und Wälder. Bauern und Gartenbesitzer verbrennen mancherorts trockenes Gestrüpp und Gras. An einer Stelle scheint das Feuer außer Kontrolle geraten zu sein. R. fährt an einem Talhang durch eine von unten kommende Rauchwand. Nach etwa 100m Metern und unter Luftanhalten war R. durch. Später kreuzen Kühe die Straße. Entspannt, ohne Eile, schauen kurz zu R. rüber und überqueren sie schmale Straße. Grenzübergang Montenegro. Formsache. Entlang der Piva fährt R. in Montenegro weiter. Bis die Straße wieder zum Schotterweg wird. Umdrehen. Andere Seite des nun zum Stausee gewordenen Flusses, da, wo der Hauptverkehr die breite Straße nutzt. Über die Straße P14 in eine spätwinterliche, aride, hügelige Landschaft. Tunnel mit engen Kurven, ohne Licht, dafür Geröll und Wasser. R. sieht die Hand vor Augen nicht. Einsam, nur manchmal Häuser oder kleine Siedlungen, mit Wellblech gedeckte Hütten und Häuser. Schnee bedeckt noch die im Schatten liegenden Hänge. Es ist kalt. Die Panoramastraße ist noch voll von Ästen, Blättern und Geröll vom Winter. Noch nicht geräumt. Über Tpca weiter in die Wildnis bis zur Tara-Schlucht und dann nach Zabljak. R. findet das Hostel nicht. Fragt sich durch. Es dauert etwas, bis er angekommen ist. Der Ort ist nicht groß, aber es gibt keine Ausschilderung. Im Hostel angekommen, fragt der Besitzer, wo er langgefahren ist und R. erfährt, dass diese Hochstraße um diese Jahreszeit normalerweise noch nicht frei ist. Glück gehabt. Der Durmitor Nationalpark ist zu dieser Zeit oft noch mit Schnee bedeckt. Trotz dieser noch kalten Zeit sind Gäste aus England, Frankreich, Australien, Schottland und Würzburg in der Unterkunft. Mit der Engländerin gehe ich Essen. Sehr beredt und etwas strange.
Stefan, der das Hostel zusammen mit seinem Bruder führt und Kettenraucher ist, geht mit mir auf eine Diskussion über den Einfluss der orthodoxen Kirche ein. Auch, wenn es eine montenegrinische orthodoxe Kirche gibt, so sind die meisten doch Mitglieder der serbisch orthodoxen Kirche. Der Patriarch sitzt in Belgrad und war ein Gefolgsmann von Milosevic. Noch heute wiederholt hängt er dessen Gedankengut an und äußert es auch entsprechend. Es gibt daher viele Spannungen zwischen der montenegrinischen Regierung und der serbisch orthodoxen Kirche.
Tag 13; Montag, 15. April 2024; Zabljak.
Lange Wanderung durch die Vorfrühlings-Landschaft mit ihrem dichten Fichtenwäldern, flachen Seen und noch braunen Almen, auf denen Krokusse zartlila Farbflecken setzen. Ausgestattet mit Birkenstock-Gummilatschen an den Füßen, da Wanderschuhe in Mostar vergessen! R. hat nun Begleitung. Ein schwarz-brauner Hund folgt ihn geduldig. Bei der Rast an einem von Fichten umgebenen See, auf einem umgestürzten Baum sitzend, bekommt er – der Hund, was er erhofft hat. Ein Stück von R.s Brotzeit. Damit ist klar, dass er R. weiter begleiten wird. Der ganzen Tag lang. Andere Hunde versuchen, ihn zu vertreiben, als beide sich der Ortschaft näherten. R. beschützt den friedlichen Hund und gibt ihm noch etwas zu fressen. Erst, als sie den Ort erreichen und sie ein Stück weit in die Straßen gegangen sind, verschwindet der Begleiter. Am Hostel angekommen, beobachtet R. drei Pferde auf der gegenüberliegende Straßenseite, die das noch spärlich wachsende Kraut zwischen den Häuser fressen.
Stefan spricht mit R. und annonciert sehr schlechtes Wetter mit Regen und eventuell Schnee. Er überzeugt R. am nächsten Tag möglichst früh am loszufahren und das Gebirge zu verlassen. Es wird hier nun für Motorradfahrer zu riskant
Tag 14; Dienstag, 16. April 2024; Fahrt nach Pristina (Kosovo); 340km.
Von Stefans Bruder erfährt R. morgens, dass die Straße nach über Mijkovac nach Berane, wo R. übernachten wollte, wegen eines Erdrutsches gesperrt ist. Also die längere, sehr abwechslungsreiche Strecke über Pljevlja und keine Übernachtung mehr in Montenegro. Gleich bis nach Pristina ins Kosovo. Der Grenzübergang ist unproblematisch. Auf kosovarischer Seite spricht man Deutsch. Der Zöllner erklärt R., wo er die KFZ-Versicherung bekommt. Ein Container, 100m entfernt, beherbergt ein Versicherungsbüro. Umgerechnet 10€ bezahlt R. für die Motorrad-Haftpflichtversicherung.
Pristina: chaotischer Verkehr, Gebäude im sowjetischen Stil oder im jugoslawischer Brutalismus gehalten, von verfallen bis modern und unfertig. Das Hostel mit Zugang im Hinterhof, verfallener Eingang. Motorrad direkt dort geparkt (besser als an der Straße? Fraglich). Pristina Center Hostel im 4. Stock, kein Fahrstuhl, kaputte Einrichtung, eine Toilette für 12 Personen.
Es regnet, als R. durch die Straßen geht; versucht sich immer wieder unterzustellen und verbringt den Abend in Cafés und Kneipen.
Tag 15; Mittwoch, 17. April; Pristina
Pristina hat einen alten Basar, hatte einen alten Basar. In den 1960ern wurde die Stadt erneuert. Altes musste weg. Heute steht dort nur ein rechtwinkliger, flacher Komplex mit einem großen, nicht genutzten und überwucherten Innenhof, um den herum gemauerte Läden stehen, die mehr verfallen als intakt sind. Daneben mit Plastikplanen überdachte Gänge, in denen sich Bude an Bude reiht und meist gebrauchte Artikel verkaufen, die anderswo nur noch im Müll landen würden: gebrauchte Kleidung und zerschlissene Schuhe, teil vom Regen durchnässt; altes Werkzeug und billige Utensilien des täglichen Bedarfs. Dort, wo die Stände noch heile sind, Kleidung aus China. Käse in einer alten Halle, von der nur der Eingangsbereich genutzt wird. Davor und in den Straßen daneben der Gemüse und Obstmarkt. Ärmlich, wie wohl auch die Bevölkerung.
In den besser erhaltenen Teilen des rechteckigen Gebäudes befinden sich ein paar kleine Imbissbuden und Cafés. R. setzt sich an einen Tisch vor einem Café und kommt mit einem älteren Mann am Nachbartisch ins Gespräch, ein Einheimischer, der zwischen Pristina und Wien pendelt. Er ist Händler. Viele Menschen vom Balkan arbeiten in Österreich. Historischer Bezug.
R. geht nach dem Kaffee, zu dem er von dem Händler eingeladen wurde, weiter, um sich neue Wanderschuhe zu kaufen. Er durchstreift die gesamte Stadt und Teile der Vororte (hat Google nach Geschäften gefragt). Findet keine Schuhe in seiner Größe. Es gibt fast keine Wanderschuhe. Man wandert nicht. Es ist kalt in Pristina.
Der Weg durch die Stadt führt an Museen vorbei, die geschlossen haben. Der Zustand ist schlecht. Die serbisch-orthodoxe Christi-Erlöser-Kathedrale auf dem Uni-Campus war der Versuch der serbischen Kirche, die im osmanischen Reich abgerissene Kathedrale zu ersetzen. Der Krieg mit Serbien beendete das Bauvorhaben in diesem überwiegend muslimischen Land (oder Provinz…) mit meist seinen ethnisch albanischen Einwohnern. Die Kathedrale ist nun von Büschen und Bäumen umwachsen und wird bald dahinter verschwinden. Gleich daneben fällt R. ein ungewöhnliches großes Gebäude auf. Das zwei-dreistöckige Gebäude scheint aus Kuben zu bestehen, die von einem Drahtgeflecht zusammengehalten werden. Dunkel und abweisend, als wolle das Gebäude den Zutritt verwehren. Es ist die Staatsbibliothek, in der auch die UNO-Truppen beherbergt waren. Innen erstreckt sich R. beim Eintritt ein kreisrunder, mit unterschiedlich farbigen, zum Zentrum führenden Steinplatten ausgelegter Raum, der einem Amphitheater nachempfunden ist. Zwei weiße Stühle stehen dort fast in der Mitte, zwei Kameras sind aufgebaut, eine elegante Frau in einem schwarzen Kostüm sitz auf einem der Stühle und telefoniert. Eine andere, die allem Anschein nach ein Interview führen wird, steht neben ihr. Der Kameramann stellt seine Apparate ein. R. geht weiter. An der Außenwand dieses Brutalismus-Baus wird in roter Schrift zur Revolution aufgefordert. 2018/19 wurde die bedrohlich wirkende Architektur auf der Ausstellung Towards a Concrete Utopia des MOMA gewürdigt.
In drei Meter großen, bunten Lettern steht vor dem Palast der Jugend und des Sports der Schriftzug „NEWBORN“. Das Wahrzeichen der Unabhängigkeitsbewegung. Zu bestimmten Anlässen werden die Buschstaben neu bemalt, ausgetauscht, verändert, um neue Bedeutungen zu stiften. Der „Palast“ dahinter füllt eine komplett versiegelte Fläche von einen Hektar aus und stammt sichtbar aus der Betonzeit Jugoslawiens. Nach einem Brand im Jahr 2000 wurde es nicht wieder komplett renoviert und befindet sich seitdem im langsamen Verfall. Graffiti, Stacheldraht, geborstene Fenster. Zustand des Landes. Arm.
Im Hostel Gespräch mit einem Iraner und einem Ägypter über den Drohnen-Angriff Irans auf Israel. R. versteht nicht, was Iran dazu bewegt hat. Der Iraner meint, dass Iran zeigen wolle, dass sie Israel jederzeit erreichen können. Iran soll nach seinen Aussagen die USA vorher informiert haben. Fast alle Drohnen wurden während des Anflugs vernichtet. Es geht nicht darum, die Ziele zu erreichen, es ging um Bilder, Gefühle und Macht.











Tag 16; Donnerstag, 19. April; Fahrt nach Skopje (Nordmazedonien), 230km.
R. tut sich schwer, dass Motorrad auf dem engen, abfallenden und mit kaputten Steinplatten übersäten Hof zu wenden und herauszufahren. Die Schranke wird vom Platzwärter geöffnet. Es geht zuerst nach Prizren, der zweitgrößten Stadt des Kosovo. Einst Vielvölkerstadt, dann Krieg und Bürgerkrieg. Heute ist die Stadt mit Blick auf das schneebedeckte Sar Planina Gebirge fast einheitlich muslimisch. Vieles wurde zerstört. R. geht über die Brücke des Bistrica e Prizrenit in die Altstadt, oder was davon noch übrig ist. Vieles wird renoviert. Man gibt sich Mühe. Es ist gepflegt. Moschee und Hamam prägen das Stadtbild. Kaffee mit Baclava und weiter geht die Fahrt nach Skopje in Nordmazedonien durch schneebedeckte Sar-Berge und ein wenig Schnee begleitet ihn am Straßenrand. In der Nacht muss es geschneit haben. Es ist kalt, zwischen null und fünf Grad.
Der Grenzübertritt nach Nordmazedonien ist problemlos und es geht weiter durch die Berge und ein breites Tal nach Tetovo, schließlich Skopje. Schon beim Hereinfahren in die Stadt bemerkt R., dass Nordmazedonien bzw. Skopje weiter ist als das Kosovo und Pristina. Obwohl wirtschaftlich noch schwach, sieht man Fortschritte im Stadtbild, verglichen mit Pristina. Die Straßen sind gepflegter, mehr hochwertige Geschäfte. Die Stadt ist christlich-orthodox (Mehrheit) und albanisch-muslimisch (Minderheit). Auch Mazedonien wurde nicht von den Unabhängigkeitskonflikten verschont. Es gab keinen Krieg, jedoch starke interethnische Konflikte.
Im Hostel lernt R. einen slowenischen Metallurgen kennen, mit dem er Wanderschuhe kaufen geht. Er kann sich mit den Leuten hier verständigen. Mit dem älteren Jugoslawen. Die jüngeren können kein Serbo-Kroatisch mehr. Sie sprechen Mazedonisch und auch Englisch. Schuhe Größe 46 gekauft. Größere Schuhe gibt es nicht. Sind sehr eng. R. hat Zweifel. Sie gehen gemeinsam Essen. Ein kleines, unscheinbares Lokal an einem Park oder Brachland, zwischen ein paar Bäumen. Landestypisches Essen mit Bier.
Tag 18; Samstag, 20. April 2024; Fahrt nach Thessaloniki (Griechenland); 250km
Es gibt nicht viele Alternativen, um von Skopje nach Thessaloniki zu fahren. Autobahn oder parallel die Landstraße. Es macht nicht viel Sinn, die Landstraße zu nehmen. R. sieht das ein und fährt einen Teil Autobahn. Bei Demir Kapija nimmt er aber wieder die Landstraße, um über Josifovo zum Dorjan-See zu fahren. Es ist Mittag und die Lokale am See laden zum Verweilen ein. Reetgedeckte Schirme stehen Reihe an Reihe am Kiesufer und bieten Badegästen Schutz vor der Sonne. Es sind keine Badenden da. Nach dem einfachen Essen geht R. ein paar Meter auf der Strandpromenade entlang. Bewegung tut ihm gut. Die müden Knochen bedanken sich. Die Grenze zu Griechenland geht durch den See. Es ist wieder ein kleiner Grenzübergang. R. ist der einzige Reisende. Schnelle Abfertigung. Dahinter große landwirtschaftliche Flächen, die intensiv genutzt werden. Hoher Wasserverbrauch. Viele der Firmengebäude hier sind in einem schlechten Zustand oder verlassen. Ödnis. Weiter auf der Landstraße nach Thessaloniki. Falsche Straße gleichen Namens als Ziel im Navi! Neues Ziel eingeben. Das Hostel „Zeus is Loose“ befindet sich zentral in einem Neubau mit Rooftopbar. R. parkt direkt auf dem Gehweg davor. Es ist warm in Thessaloniki. Angenehm warm. R. geht nach dem Einchecken in die Bar im 6. Stock und bestellt ein Bier. 5€. Teuer.
Es gibt einen Bus zur Burg auf dem nahen Berg. Von dort sieht R. gut ein Dutzend Schiffe vor Anker liegen; meist Fracht- und Containerschiffe, aber auch ein Tankschiff. Dicker Qualm kommt aus einem ihrer Schornsteine und weht Richtung Stadt. Zu Fuß zurück in die Innenstadt. Die engen Stadtviertel nahe der Burg sind teils historisch, teils in den letzten Jahrzenten gebaut worden. In einer Seitenstraße des Hostels findet R. ein Restaurant, dass noch vernünftige Preise hat. Anschließend geht er in einem Lokal, in dem zwei Musiker traditionelle Musik spielen. Er nimmt ein Bier und hört den fünf Frauen am Nachbartisch zu, die anscheinend Geburtstag feiern. Sie kommen ins Gespräch über die Musik. Sie stammt aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und spiegelt die schlechte Lage der Bevölkerung nach der kleinasiatischen Katastrophe wider. Nachdem Griechenland den Krieg gegen das geschwächte osmanische Reich verloren hat und der Lausanner Vertrag umgesetzt wurde, kam es zu einem Bevölkerungsaustausch in Griechenland und der Westtürkei: biete Griechen – nehme Türken. R. erzählt ihnen von seiner Reise. Eine der Frauen gibt ihm etwas Geld, um für sie auf Berg Athos eine Kerze anzuzünden. Es sind sehr unterschiedliche Frauen: z.B. eine B&B-Besitzerin und eine Studentin, die Touristik studiert und Deutsch lernt, damit sie zu ihrer Freundin nach Herzogenaurach (nicht weit von R.s Wohnort!) ziehen kann. Ein Klarinette-spielender Zigeuner kommt mit seinem dazu trommelnden Sohn in das Lokal und sie spielen auf. R. gibt ihnen ein Trinkgeld. Es ist schon dunkel, als R. das Lokal verlässt und zum Hauptplatz, der nach Aristoteles benannt ist und am Meer liegt, geht. In der Ferne Wetterleuchten. R. macht Fotos von der eindrucksvollen Szene und geht durch das belebte Hafenviertel mit seinen vielen Kneipen und Restaurants zurück zum Hostel.
Tag 19; Sonntag, 21. April 2024; Thessaloniki.
R.s Plan für heute: Rundfahrt mit einem Hop-on-Hop-off Bus. Daraus wird nichts. Es findet ein Triathlon statt und viele Straßen sind dafür gesperrt. Spaziergang an der Uferpromenade zum Weißen Turm, der im 15./16. Jahrhundert erbaut wurde. Seinen weißen Anstrich bekam er erst Ende des 19. Jahrhunderts, als der jüdische Gefangene Nathan Guidili anbot, den Turm weiß zu streichen, um dafür im Gegenzug freigelassen zu werden. Oben angekommen, wohnt R. einem Hochzeitsantrag bei. Ein junger Mann kniet mit einer kleinen Schatulle in Händen vor einer Frau und hält um ihre Hand an. Sie nimmt an, erhält den Verlobungsring und beide umarmen sich glücklich und zufrieden.
R. geht in das nahe Byzantinische Museum und die Panagea Dexia Kirche, mit ihrem eindrucksvollen Innenraum. Etwas planlos läuft R. durch die von 6-7-stöckigen Häuserfronten aus den 70er und 80er Jahren eingerahmten Straßenzüge. Thessaloniki musste sich mehrfach neu erfinden. 1917 wurde es durch ein großes Feuer schwer zerstört. Dreiviertel der Altstadt und ein Drittel der gesamten Stadt lagen in Schutt und Asche, nachdem es in einer Flüchtlingsunterkunft zu einem Brand kam, der sie rasend schnell über die gesamte Stadt ausbreitete. Fast 80.000 Menschen wurden damals obdachlos: unter anderem 50.000 Juden, 12.500 Orthodoxe, 10.000 Muslime. Anschließend wurde die Stadt wieder aufgebaut. Es kamen dann im Anschluss an die kleinasiatische Katastrophe viele Vertriebene dazu; nach dem zweiten Weltkrieg setzte zusätzlich die Landflucht ein und die Städte mussten erneut Wohnraum schaffen. Das Ergebnis sieht man heute noch. So geht R. von einer Straßenecke zur nächsten, von einem Jahrhundert ins nächste, durchstreift mit wenigen Schritten Jahrtausende.
Tag 20; Montag, 22. April; Thessaloniki.
R. entscheidet sich kurzfristig, einen weiteren Tag und eine Nacht in Thessaloniki zu verweilen, um mehr über die Stadt und ihre Bewohner zu erfahren. Sein erster Gang führt ihn auf den basar-artigen Kapani-Markt. Ein breites Angebot an Obst, Gemüse, Tierischem, wie Schafsköpfe und Gedärme, bietet man hier feil. Der Markt lädt zum Fotografieren ein. Mittags gönnt er sich dort einen Imbiss gegenüber einem Olivenstand. Dessen fein säuberlich angeordnete Auswahl ist riesig. Würde R. von jeder Sorte nur eine essen, so wäre er satt. Ein älterer, sehr dicker Herr mit orangener Kappe scheint genau das zu tun. Da ihm anscheinend etliche Zähne fehlen, sieht sein Gekaue aus, wie das einer Kuh. Verkäufer und er scheinen sich zu kennen. Nach einiger Zeit kommt seine Frau hinzu und sie kaufen Oliven. Eine Tüte voll, etliche Pfund! Man kennt sich hier. R. kauft 200g.
Wieder geht R. durch die Marktgassen, macht Fotos. Weiter zur Uferpromenade Richtung Weißer Turm, um eine Busrundfahrt zu machen. Polizeiwagen rasen mit Blaulicht und Martinshorn an R. vorbei. Auch Rettungswagen. In der Ferne, am Weißen Turm, halten sie an. Dort, wo gestern noch der Mann seiner Geliebten einen Heiratsantrag machte, hat sich – oder ist - ein Mann vom Turm gestürzt. Er liegt noch da, als R. dort ankommt. Bedeckt mit einer Plane. Schaulustige stehen am Absperrband. Betroffenheit. R. geht ergriffen zum Hostel zurück und nimmt an einer Stadtführung, die in der Nähe ihren Startpunkt hat, teil. Sehr spannend führt ein Historiker die Gruppe durch die Stadt.












Tag 21; Dienstag, 23. April; Fahrt nach Ouranoupoli, 150km.
Es ist nicht weit von Thessaloniki bis zum kleinen Ort Ouranoupoli auf dem östlichsten Finger von Chalkidiki. Daher wählt R. die kurvige Route durch die Berge. Am Kloster Anastasia Farmakolytrias macht R. seinen ersten Halt. Eindrucksvoll liegt das riesige Kloster an einem sanften Bergrücken im wabernden Nebel und strahlt in seiner Farbigkeit Freude aus. Gegründet 888 und nach Zerstörung 1930 wieder aufgebaut ist es von außen tadellos. R. betritt das Kloster, dessen große Pforte geöffnet ist und schaut sich um. Blau-weiße Fahnen säumen den arkadenartigen Rundgang und sind ein Spiel des Windes. Dazwischen kleinere, gelbe Fähnchen der griechisch-orthodoxen Kirche. Die Innenräume des schmalen Wohntrakts sind zum Teil verlassen. Verfallen. Schutt füllt einige der dunklen Kammern. Der Garten verwildert. Im Katholikon wird R. die ganze Pracht der orthodoxen Kirche entgegengeworfen. Langsam zeichnen sich in der Dunkelheit des hohen Raumes Strukturen, Gemälde und zahlreise Utensilien ab, in Rot, Gold, Grün und Blau. Auf einer Leiter steht eine Frau und restauriert mit einem feinen Pinsel ein Marienbild. Ein bärtiger Mann geht durch den Raum und trägt Dinge hin und her, räumt auf. Der Priester. Ein kurzes Gespräch über Pracht und Schönheit folgt. Beeindruckt geht R. in das spröde Lokal neben der Kirche – hier scheint es viele Gläubige und Besucher zu geben, auf die die Wirte warten. Er trinkt einen Kaffee an einem Fenster mit Blick vom Berg hinab auf die Ebene und fährt dann weiter durch die bewaldeten Berge, teils durch Nebel, der dem Ganzen einen geheimnisvollen Anstrich verpasst. Mitten im Wald trifft R. auf eine Schänke mit Restaurant. Angekündigt wurde es mit dem Schild „Restaurant berühmt“. Deutsche Gäste scheinen hier eine wichtige Einnahmequelle zu sein. R. wird freundlich empfangen und der Wirt führt in an einen Tisch vor dem Kamin. Ein weiterer Tisch ist bereits mit drei Handwerkern besetzt und neben dem Kamin steht ein Laufstall für das kleine Kind der Familie. Es gibt keine Heizung. Es ist kalt. Nur am Kamin ist es ein wenig warm, fast schon angenehm. Der Wirt setzt sich zu R.; er spricht ein paar wenige Worte Deutsch. Sie suchen gemeinsam das Essen aus. Der Wirt schlägt viele Sachen vor; R. sagt hier und da „ne(in)“. Als jedoch fast alles auf dem Tisch steht, erinnert sich R. daran, daß „nai“ auf Griechisch „nein“ bedeutet. Nun gut, es schmeckt und R. isst tapfer alles auf. Das Wirtshaus hat bessere Zeiten erlebt. Die Einrichtung ist verbraucht, chaotisch und zeigt verschiedene Stilrichtungen. Kaputtes wir repariert oder durch Dinge ersetzt, die nicht zusammenpassen. Nun gut, es ist authentisch und erinnert R. ein wenig an das „Wirtshaus im Spessart“.
Nach Ouranoupoli fährt man den Bergrücken hinunter. Aussicht auf das graue Meer zu beiden Seiten. Wer hier entlang fährt, will meist auf den Berg Athos oder lebt vom Tourismus. R. ist zwei Tage früher dort, als geplant. Um Geld zu sparen, geht er nicht in das reservierte Hotel, sondern auf einen Campingplatz vor der kleinen Stadt. Der hat gerade erst aufgemacht und ist noch nicht voll funktionsfähig. Nur die bereits in die Tage gekommenen Sanitäranlagen funktionierten. Vier Wohnmobile waren bereits dort, Deutsche, Holländer, Schweizer. R. baut mühsam das kleine, rote Zelt auf. Wo ist vorne, wo hinten. Es braucht immer etwas Zeit, bis R. die Routine entwickelt, bis der Aufbau leicht von der Hand geht. Das ziemlich große Lokal des Campingplatzes ist noch geschlossen. R. fährt nach Ouranoupoli und kauft ein paar Dinge ein. Nach einem spartanischen Abendessen sitzt R. mit zwei deutschen Pärchen zusammen. Blick auf das Meer. Nur weiße Plastikstühle stehen zur Verfügung. Der Abend ist kühl und sie trinken gemeinsam Wein. Reden über alles Mögliche. Es ist dunkel geworden.
Tag 22, Mittwoch, 24. April 2024, Campingplatz Ouranoupoli.
Zum Frühstück in den Ort. R. wird an der Uferpromenade permanent von den Restaurantbesitzern eingeladen, bei ihren zu frühstücken. Die Konkurrenz ist groß. Alle bietet jedoch das gleiche an. Pilger sitzen in den Lokalen, gehen zielstrebig vorbei, stehen zusammen, reden, lachen. Meist Osteuropäer oder Griechen. Sie gehen zum Schiff oder zu den kleinen Wassertaxis. Ihr Ziel ist die autonome orthodoxe Mönchsrepublik Athos auf dem östlichen chalkidischen Finger. Die „Landgrenze“ ist nicht offen. Frauen und weibliche Tiere (außer Katzen für die Schädlingsbekämpfung) dürfen seit dem Jahr 1045 nicht auf die Insel und müssen 500m Abstand zum Ufer halten (dieses Weltkulturerbe verstößt damit gegen viele EU-Gesetzte. R. sieht Athos daher eher als lebendiges Museum). 20 Klöster, ca. 2000 Mönche, zusätzlich Personal, Polizisten, Arbeiter und Pilger auf 336m2. Neben griechischen befinden sich heute noch ein russisches, ein bulgarisches, und ein serbisches Großkloster auf dem Gebiet der Mönchsrepublik. Russland versucht mit großem finanziellem Aufwand seinen Einfluss in der Republik und der gesamten Orthodoxie auszubauen. Die griechische Regierung versucht dagegen zu steuern. Die religiöse Ausrichtung der Klöster ist unterschiedlich. Manche beharren auf dem ursprünglichen Ritus, andere entwickeln sich weiter. So gibt es permanent Streit in der „Mönchsregierung“, die sich aus den 20 Klöstern rekrutiert. Auf der Insel gilt der julianische Kalender (13 Tage zurück im Vergleich zum gregorianischen). Die meisten Klöster nutzen zudem die italienischen Stunden. Sonnenuntergang ist null Uhr. Nur Iviron fängt den Tag mit dem Sonnenaufgang an (babylonische Stunden).
R. beobachtet Pilger, die von Athos kommend, den Ort durchqueren. Versucht, ihnen anzusehen, ob sie anders sind, als die Pilger, die zu den Schiffen gehen. Er erkennt keinen Unterschied. Die meisten sind schwer bepackt, die wenigsten haben Wanderkleidung. R. vermutet, dass sich die meisten auf der Halbinsel fahren lassen. R. wird zu Fuß gehen.
R. hat es geschafft, einen der 10 Plätze, die täglich an nicht-orthodoxe vergeben werden, zu ergattern. Das hat er bereits vor Monaten eingeleitet, indem er an die Stelle zur Vergabe der Einreisegenehmigung in Thessaloniki geschrieben hat. Er braucht nur noch das Dokument (Diamonitirion) aus dem Pilgerbüro hier in Ouranoupoli. Heute nicht, heißt es dort. Erst, wenn R. abfährt, also früh morgens.
Um den Tag zu verbringen, bucht R. für den Nachmittag eine Fahrt mit dem Ausflugsschiff, dass bis zur Spitze der Halbinsel fährt. Bis dahin geht R. am Ufer entlang und fotografiert die kleinen, roten und blauen Fischerboote, die am Strand liegen. Der alte, markante, aus dem 13. Jhd stammende Prosphorios-Turm, prägt den Ort. Teilweise ist er zu besichtigen. Ein englisch-australisches Ehepaar (Joice und Sydney Loch), das eine Teppichweberei im Ort hatte und sich sozial engagierte, waren die letzten Bewohner. Seitdem ist es Museum. Das Ausflugsschiff fährt nicht. Die Information kommt erst zur Abfahrtszeit. Menschen warten und verstehen nicht, warum die hier so klein wirkenden Wellen für das Schiff zu groß sind. R. lässt sich enttäuscht das Geld zurückerstatten. Genervt von der Art der Kommunikation geht er spazieren. Zur „Landesgrenze“, um zu sehen, ob sie wirklich geschlossen ist. Der Weg führt über sandige Wege und schmale Pfade bis zu einem kleinen Bach. Dahinter die autonome Mönchsrepublik. Ein hoher Zaun versperrt den Zugang zur anderen Seite, auf der sich ein paar Gebäude in schlechtem Zustand befinden. Niemand zu sehen. Große, rot-weiße und gelbe Schilder warnen vor dem Zutritt für Frauen, dem Zutritt ohne Genehmigung und dem Ankern am Ufer: „Verstöße werden streng geahndet“. Neben einer versperrten Durchfahrt für Autos und LKW gibt es einen Zugang für Fußgänger, der mit einem Holztor und einem großen Stoppschild darauf versperrt ist. Hier an der Grenze zur Mönchsrepublik, wo der Bach sich ins Meer ergießt, treffen große Wellen an Land und brechen mit Getöse auf den mit großen Kieseln übersäten Strand. Am Ufer der Mönchsrepublik gibt es ein paar Gebäude, deren Holzbalkone und Tore dem Verfall preisgegeben werden.
Für den Rückweg wählt R. eine andere Route. Durch das niedrige Gebüsch, schmale Pfade. Blühendes überall. R. empfindet die Gegend guttuend, beruhigend. Schön.
Im Ort geht er noch durch die Gassen, besucht die orthodoxe Kirche, bewundert die prachtvoll blühenden Bourgainvillea an den Häuserwänden und kauft etwas für das Abendessen ein. Thunfisch und Salat. R. sitzt diesmal am Abend mit anderen Deutschen zusammen. Man teilt sich Wein und Raki vor dem Schlafengehen.
Tag 23; Donnerstag, 25. April; Ouranoupoli, Hotel.
Ab heute ist R. im lang vorher gebuchten Hotel. Das Zimmer kann er bereits um 10h beziehen. Großartig. Von hier kann er morgen früh ausgeruht und ohne Hektik zur Fähre gelangen. R. bespricht mit der Besitzerin die Möglichkeit, Motorrad und Motorradklamotten im Hotel zu lassen, während er mit dem Rucksack auf Berg Athos ist. Kein Problem. R. ist erleichtert und bedankt sich bei der netten Frau.
Er ist sich unsicher, welche Route er in der Mönchsrepublik nehmen und ob er den Aufenthalt verlängern soll. Drei Nächste werden nur genehmigt. In der Hauptstadt könnte R. seine Genehmigung verlängern lassen Er hat die erste Übernachtung im Kloster Koutloumousiou nahe der „Hauptstadt“ Karyes gebucht. Die zweite im Kloster Philotheou. Nur eine Nacht darf man jeweils im Kloster verweilen und muss dann weiter. In Karyes wird er sich entscheiden müssen, wohin ihn sein Weg führen wird.
Um die Zeit totzuschlagen, sitzt R. wieder im Café und beobachtet Pilger. Er hat versucht, mit ihnen in Kontakt zu treten. Sie sind aber meist in Gruppen und sehr mit sich selbst beschäftigt. Noch nicht und nicht mehr aufnahmefähig
Nur mit österreichischen Bustouristen kommt er ins Gespräch. Diese Busse hatte er auch in Thessaloniki schon gesehen. Es ist eine österreichische Pensionärsorganisation. Sie sind mit vielen Bussen unterwegs und überschwemmen die Orte. Die Busse kommen nicht alle am gleichen Tag an, sondern versetzt Tage. Wie eine langgezogene Karawane durchstreifen sie den Balkan bis hier nach Athos. R. geht wieder in den umliegenden Hügeln spazieren. Der Abend ist einsam.
Tag 24; Freitag, 26. April; Ouranoupoli
R. verbringt den Tag mit Kaffee trinken, Essen und spazieren gehen. Beobachtet die kommenden und nach Athos fahrenden Pilger. Das Treiben wiederholt sich. Tagaus, tagein. Mit der Zeit mutet es fast wie ein Automatismus an, als wenn sie sich nach bestimmten Spielregeln bewegen. Nicht Menschen, nicht Pilger, Playmobilfiguren verlassen wie eine amorphe Masse die Schiffe und gleiten wieder in sie hinein. Manche machen Erinnerungsfotos. Mönche bringen Waren mit Caddys aufs Schiff, andere nehmen Pilger mit an Deck. Sind Ansprechpartner. Ein beleibter Pilger hat anscheinend seine Diamonitirion vergessen zu holen und läuft zum Büro. Nach einiger Zeit kommt er schwer atmend wieder am Schiff an. Es wurde Zeit. Das Schiff legt ab. Pilger schauen vom Deck zurück. In Ouranoupoli geblieben schauen zum Schiff. R. auch. Abend packt er sorgsam seinen Rucksack. Hat Nüsse und Feigen für den Notfall mit.
Tag 25; Samstag, den 27. April; Karyes und Kloster Koutloumousiou, Berg Athos
Etwas nervös ist R. Nicht verschlafen. 5 Uhr aufstehen, um zum Büro der Mönchsrepublik und zum Fährschalter zu gehen. 6 Uhr dort sein. Bereits an die hundert Männer stehen vor mir am Schalter für die Fähre. Ruhiges Gedränge. Niemand drängelt, jedoch ist sich jeder bewusst, wie wertvoll sein Platz ist. Man lässt niemanden vor. Manche stehen für eine kleine Gruppe an, andere nur für sich. Es geht beständig weiter nach vorne. Nur Hinwegfahrkarte gekauft. Rückweg bei Rückfahrt. R. erkundigt sich, ob er bis zur letzten Station und dann wieder zum Anleger Daphni für Karyes zurückfahren kann. Ja. OK. Weiter zum Pilgerbüro der Mönchsrepublik. Ist gleich nebenan. Wieder anstehen. Noch mehr Gedränge, da das Büro eng ist. Am Schalter angekommen. Pass, Bestätigungs-Email des Pilgerbüros in Thessaloniki zeigen und wo erste Übernachtung mit Nachweis; welche Konfession. Diese Frage hat R. nicht verstanden und ein Pilger hinter ihm sagte es ihm dann. Zu spät, der Beamte hat „keine Religion“ eingetragen. Diamonitrion entgegennehmen, zum Schiff gehen. Geschafft. Wieder anstehen, Polizeikontrolle für die „Ausreise“, Fahrkartenkontrolle. Das Schiff ist voll. Die Stimmung entspannt sich. Jeder sucht sich ein Plätzchen. Auf Deck, um zu sehen, wer noch alles kommt und wer spät dran ist, um die Möwen zu füttern. Kalt ist es so früh morgens noch. Windig. Unter Deck gibt es Kaffee. Die Sitzplätze sind meist besetzt. R. findet noch einen Platz. Kommt mit anderen ins Gespräch. Andere Pilger unterhalten sich mit einem Mönch. Der geht von einem zum anderen, lächelt, verbreitet gute Laune. Holt sein Handy raus, telefoniert. Letzte Passagiere laufen zum Schiff. Schaffen es noch, bevor es ablegt. 7h00, es geht Richtung Mount Athos. Er erscheint hinter einer Landzunge. Teils Wolken-verhangen, der Gipfel frei. Majestätisch liegt er vor uns, als wäre er allein im Meer. Der Dunst grenzt ihn vom Festland ab, obwohl er Teil der Halbinsel ist.
Langsam tauchen die ersten Klosterburgen auf. In die Flanke der bergigen Halbinsel gebaute Klöster, groß, wie eine kleine Stadt. Gewaltig, wehrhaft. Piraten haben sie über die Jahrhunderte immer wieder geplündert. Am Ufer befestigte, zur Verteidigung ausgelegte Anleger für die in schwindelerregender Höhe, Schwalbennestern gleich, hängende Klosterstädte. An jedem Halt verlassen Pilger und der ein oder andere Mönch das Schiff. Dort warten Autos oder auch Maultiere. Werden von Mönchen mit Schürzen und Hilfskräften beladen. Gepäck und Pilger transportieren sie die steilen Hänge hinauf. Ein kalter Wind peitscht am Ufer entlang. Die Männer sind warm eingepackt. Es geht weiter, bis an die Spitze der Halbinsel. Schnelle Boote mit Pilgern überholen uns. Manche fahren weiter, um den Berg herum. R.s Schiff macht wie geplant kehrt. Jetzt steigen Pilger und Mönche ein. R. macht Bilder von regen Treiben an Land. Zurück bis Daphni, dem Anleger von Karyes. Schnell sein, um einen Platz im Bus zu ergattern und nicht die 6 km auf einer staubigen Straße steil bergauf gehen zu müssen. Spätestens 13 Uhr muss R. im Kloster Kouloumousiou sein. Der Bus hält in Karyes, der Hauptstadt. Klein und gepflegt. Viele Läden mit religiösen Artikeln und etwas Kitsch. Einige Lokale, ein Bäcker. Verwaltungsgebäude und in der Ortsmitte eine Kirche. R. nimmt den kurzen Weg zum Kloster in Angriff. R.s Herz klopft. Wie wird es sein, in einem Kloster zu übernachten? Nachdem er durch das Klostertor geschritten ist, findet er nach kurzem den Quartiermeister. Der weist R. ein Zimmer im zweiten Stock zu. R. teilt sich sein Zimmer mit einem 81-jährigen Griechen. R. trifft noch einen Finnen, der in Kiel BWL studiert hat, einen Italiener und zwei Deutschen, die schön öfters auf Berg Athos waren. Es gibt eine Dusche mit kaltem Wasser. Nachdem R. sich eingerichtet hat, geht er zusammen mit dem Finnen in den Ort, um seine Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern. Geschlossen. Es ist Samstag. Somit wird es nichts mit der Verlängerung. Andere Pilger berichten, dass man auch ohne Verlängerung etwas länger bleiben kann. Also alles gut, für den Fall, das R. sich dazu entscheidet. R. erfährt, dass morgen Palmsonntag ist und damit die Karwoche beginnt. Der julianische Kalender. Daher sind auch viele Pilger da. R. jubelt innerlich. Es wird viel los sein. Viele Gelegenheiten zu beobachten und zu fotografieren. In den Kirchen jedoch ist Fotografieren verboten. Filmen ist auf der gesamten Insel verboten. Motive gibt es aber überall.
Um 16 Uhr ist Andacht. Von der Kirche im Innenhof des Klosters geht R. mit den anderen Pilgern und den Mönchen zum Abendessen. Das Refektorium ist voll. Mönche, orthodoxe und nicht-orthodoxe Pilger essen gemeinsam, da dieses Kloster alle Gäste willkommen heißt und gleichberechtigt aufnimmt. Das tun nicht alle Klöster in der Mönchsrepublik. Seit langem streiten die Klöster um ein gemeinsames Verständnis von Religion und Gläubigkeit. Nach einem Gebet gibt es Gemüsesuppe, Zucchini, Oliven, Wasser, ½ gekochten Pfirsich, Brot. Während des Essens wird aus der Bibel gelesen und geschwiegen.
Anschließend gehen alle gemeinsam in die Kirche zum Gottesdienst. Nach der hiesigen Zeitrechnung fängt der Tag mit dem Sonnenuntergang an. Also haben wir gleich Sonntag und es ist somit die Palmsonntagsmesse, die gleich beginnen wird. Alle nehmen teil. Sie beginnt um 18h30 und wird bis Mitternacht dauern! Alle wurden aufgefordert, sämtliche Teile der Messe aktiv zu begleiten: Ikonen küssen, silbernes Evangelium küssen (R. tat nur so als ob, woraufhin ihm der Priester etwas später erklärte, dass das Küssen des Evangeliums einem Kuss Jesu gleichkommt. R. fühlt sich ertappt), Ring des Abtes küssen. Palmwedel erhalten, herumgehen. Handschuh eines Mönchs küssen, der dann mit einem Silberstab ein Kreuz auf meine Stirn gezeichnet hat. In der Kirche gibt es kein elektrisches Licht und da Nacht ist, kommt auch kein Licht durch die spärlichen Fenster. Die Kirche hat überall Kronleuchter und Öllampen, die je nach liturgischem Abschnitt angezündet oder geloschen werden. Sie werden dazu entweder mit einem Docht an einer landen Stange angezündet oder sie lassen die Leuchter dazu an Seilen herunten. Trotz der vielen kleinen Lampen ist die Kirche in ein geheimnisvolles Licht getaucht, dass R. manchmal nur erahnen lässt, was wo vor sich ging. Während des Gottesdienstes findet eine Art Dialog statt. Auf der linken Seite singt oder spricht ein Mönch einen Text, auf den von einem Mönch auf der gegenüberliegenden Seite geantwortet wird. Es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen von Mönchen und Gläubigen. Manche Mönche gehen auch vom Hauptraum in die dahinter liegende, vom Rest abgetrennte Ikonostase. Einige kleine Öffnungen erlauben R. einen wagen Blick in diesen etwas geheimnisvollen Ort. Von Zeit zu Zeit setzen die Mönche ihre Mütze ab und tragen anstatt dessen ein schwarzen Tuch oder keine Kopfbedeckung. Zwischendurch sieht R. Pilger etwas kauen. Im Eingangsraum der Kirche kann man mit einem silbernen Schälchen (eins für alle) etwas Wasser aus einem Kübel schöpfen und trinken. R. macht das nicht. Dafür nimmt R. sich Brot, dass in eine Flüssigkeit getunkt ist (Wasser mit Honig?). In der Kirche gibt es auch eine Art Vorraum, von wo aus R. alles sehen kann. Gelegentlich geht er jedoch in die Haupthalle. Im Hauptraum und in diesem Vorraum befinden sich Chorstühle, in denen R. entweder sitzen kann oder die Ellenbogen aufgestützt halbwegs oder gänzlich stehen kann.
Alle Innenwände der Kirche sind vollständig ausgemalt. Häufig dunkel, im Vorraum mit erschreckenden Szenen der Hölle und im Hauptraum mit der Erlösung von den Qualen. Das muss den Menschen früher (heute noch?) Angst gemacht und gleichzeitig einen Ausweg aufgezeigt haben.
Nach dem Gottesdienst, gegen Mitternacht, geht R. zu Bett.




















Tag 26; Sonntag, 28. April 2024; zum Kloster Philotheou; Palmsonntag
R. geht um 6 Uhr 30 zum Gottesdienst. Er dauert nur zwei Stunden. Anschließend Frühstück. Nudeln mit Meeresfrüchten. Die Männer schlagen sich den Magen voll. R. hält sich zurück. Zu früh für Tintenfisch.
Im Ort kauft R. eine schöne Marien-Ikone mit dem Jesu-Kind für seine Frau.
Der Weg führt R. über eine Schotterstraße und dann durch Wälder mit schmalen, teils fast verschwundenen Wegen. Nur zu Beginn war der Waldweg noch erhalten, wurde aber bereits erneuert. Danach dicht bewachsen, von Gestrüpp überwuchert. Halb verfallene Brücken führen über rauschende Bäche. An den Hängen nur mannsbreit mit fehlenden Pflastersteinen. Auf seinen Tritt achten. Bäche nutzen den einst gepflasterten Weg und fließen langsam über die Steine. An gemauerten Quellen stehen Tassen und Becher für die Pilger bereit, um den Dursch zu löschen.
Langsam taucht das Kloster Philotheou vor R. auf. Es ist riesig, von Wein und Ostbäumen umgeben. Über dem ersten Stock bunte, geschlossene Balkone mit den Kammern für Mönche und Pilger. Alles ist in einem guten Zustand. Ein Rosengarten vor dem großen Eingang mit einem kleinen Bach, der durch den Garten fließt.
Im Kloster ist Fotografieren nicht erwünscht. Philotheou ist anders als das vorherige Kloster streng auf die ursprüngliche, traditionelle Lebensweise ausgerichtet. Beim Gottesdienst durfte R. nur im Vorraum der Kirche zugegen sein. R.s Anwesenheit in der eigentlichen Kirche während der Zeremonie wäre Häresie! Er sprach lange mit seinen Zimmergenossen. Alles Griechen (einer aus Düsseldorf), die regelmäßig nach Athos kommen und die traditionellen Klöster bevorzugen. Alle waren zutiefst gläubig und erschienen R. sehr fundamentalistisch. Teilweise kamen Verschwörungstheorien auf zu diversen Themen. R. fühlt sich unbehaglich. Die Männer finden hier Zuversicht und Halt. Sie nehmen das biblische Wort wörtlich und stellen es nicht in Frage. R. ist erstaunt, dass Menschen so devot sein können und gleichzeitig entweder liebevoll, inkludierend oder ausgrenzend (alles andere ist Häresie). Sie akzeptieren R. und geben ihm ein Buch von Bruder Symeon Kragiopoulos für die tägliche Andacht. R. ist beeindruckt von diesen Pilgern.
R. darf nicht am Abendessen der Mönche und Pilger teilnehmen. Er muss warten, bis sie fertig sind und bekommt dann sein Essen, während bereits die Tische im Refektorium abgeräumt werden.
Tag 27; Montag, 29. April 2024; zum Kloster Iviron
Gottesdienst von 3-7 Uhr. R. nimmt nur zeitweise daran teil, von 4-5 Uhr, und sitzt im Vorraum der Kirche. Es lauscht den Mönchen. Schaut durch die Fenster. Es ist sehr dunkel drinnen. Wie in einer Gruft. Geruch von Weihrauch und Stimmen der Litanei strömen durch ein offenstehendes Fenster. Er legt sich wieder schlafen und kommt gegen 7 Uhr zum Ende des Gottesdienstes wieder zur Kirche.
Sachen packen, etwas essen und dann weiter zum nächsten Kloster. R. hat zwei Möglichkeiten: Karakallu oder Iviron. Er entscheidet sich für Iviron. Sollte er dort keinen Erfolg haben, so kann er immer noch zum anderen Kloster zurückgehen. R. weiß, dass die Klöster Pilger, die über die Klosterschwelle getreten sind, nicht zurückweisen dürfen. Auch ohne Anmeldung. Der Weg führt ihn zuerst zum Kloster Karakallu, das zu schlafen scheint. Nach der Morgenandacht ist „Nachtruhe“. Nur ein Mönch sitz auf einer Bank im Hof und fragt nach seinem Anliegen. R. gibt ihm zu verstehen, dass er sich für die Architektur interessiert. Der Mönch läßt ihn gehen, behält ihn aber stets im Auge. An einem Türmchen befindet sich die Aufschrift: „Esti men oyn Ellas kai h’Makedonia“, zu Deutsch „Griechenland ist auch Makedonien“. Klares Bekenntnis zu Makedonien als Teil Griechenlands und gegen den Staat (Nord)-Makedonien. Weiter geht es auf einem Schotterweg entlang dem Meer. Unterwegs trifft R. noch einen japanischen Pilger, den er im Kloster Iviron wiedersehen wird. Etwas weiter fließt ein kleiner Bach über den felsigen Weg Richtung Meer. In der Ferne erkennt man das Kloster Iviron, das auf einem Felsen nahe dem Meer gebaut wurde. Am Anlieger des Klosters liegen kleine Boote auf dem Trockenen. Baumstämme lagern überall, bereit zur Abholung. Neben dem Kloster gibt es eine Reihe von Wirtschafts- und ein paar Wohngebäude. Niemand ist zu sehen. Iviron ist nach Koutloumousiou das Zweithöchste in der Reihenfolge der zwanzig Klöster. Auch dieses Kloster verfolgt eine Annäherung an andere, modernere Kirchen, wie der katholischen und der protestantischen. Über die Schwelle getreten, konnte der „guestmaster“ R. nicht mehr rauswerfen. Er ist nicht erfreut und meinte, dass man sich anmelden solle, genauso wie man es bei Hotels mache. R. muss ziemlich lang warten, bis ihm ein Bett zugewiesen wird. Ein Doppelzimmer zur alleinigen Nutzung. Im Gästegebäude befindet sich im Erdgeschoss auch eine gut ausgestattete Küche mit Kaffee und Tee sowie Lokkum! Dort trifft R. auf den japanischen Pilger und unterhält sich kurz mit ich. Er erzählt, dass es hier im Kloster auch einen japanischen Mönch gibt. R. sieht später beide gemeinsam im Klosterinnenhof umhergehen. Trifft auch noch einen koreanischen, einen moldawischen und zwei georgische Pilger. Dieses Kloster wurde vor über 1.000 Jahren von einem georgischen Mönch gegründet und ist daher das Ziel georgischer Pilger. Ein georgischer Pilger gibt R. seine Telefonnummer. Er soll anrufen, wenn er in Tiflis ist.
Zum Mittagessen gibt es Meeresfrüchterisotto, Gemüse und Obst. Auf Berg Athos ist das Essen von Fleisch verboten. Meeresfrüchte sind jedoch erlaubt. Danach legt R. sich schlafen. Hat Kopfschmerzen. Verpasst das frühe Abendessen. Ist pünktlich zur Messe danach anwesend. Auch nicht-orthodoxe Pilger nehmen an der Messe teil. Vor und nach dem Gottesdienst wird viel gesprochen auf dem Platz vor der Kirche. Man steht beisammen, Pilger und Mönche. Die Atmosphäre ist entspannter als im Kloster Philotheou. Der Klosterinnenhof ist sehr groß, enthält auch einen mit einem Burgfried ummauerten Wehrturm. Zahlreiche große Bäume spenden Schatten.
Tag 28; Dienstag, 30. April 2024; vom Berg Athos nach Kavala; 160km
Die Fähre gegen Mittag nach Ouranoupoli muss R. heute erreichen. Er wird den Aufenthalt nicht verlängern. Es ist 7h30, als er losgeht. Zwei Stunden lang keine Begegnung, entspannend in einer schönen, fast wilden Natur. R. nutzt die App „Mapy“ und die kyrillischen Hinweisschilder, um sich zu orientieren. Kapellen und Brunnen mit selbst gebauten Kreuzen, Jesus- und Marienbildchen am Wegesrand. Kleine Bäche und skurrile Bäume begleiten ihn. Von Karyes geht es dann mit dem Bus zum Anleger nach Daphni. Es ist voll; viele Pilger warten auf die Fähren. Die Gebäude des kleinen Hafens sind teils verfallen, teils ungepflegt. Es gibt Arbeiterwohnungen, die nicht einladend aussehen. Pilger kaufen letzte Andenken. R. nimmt das Speedboot zurück nach Ouranoupoli. Es ist ruhig auf dem Boot. Die Menschen sind müde. Ein Pilger ist auf seinem Platz eingenickt, während er zwei Bienenwachskerzen in Händen hält. Frieden mit sich. Griechische Pilger empfehlen R., der ihnen von seiner Reise erzählt, auf Lesbos die Karfreitagszeremonie zu besuchen. Die Gläubigen sollen dann, von den verschiedenen Stadtteile zum Hafen von Mtytiline kommen und Lichter über dem Meer aufsteigen lassen.
In Ouranoupoli nimmt R. seine Klamotten in Empfang, steigt auf sein Motorrad und fährt ins nur zwei Stunden entfernte Kavala, um am nächsten Tag die Fähre nach Lesbos zu nehmen.
Tag 29; Mittwoch, 1. Mai 2024; Fähre nach Mytiline auf Lesbos.
Auch Kavala ist in den letzten Jahrzentren schnell gewachsen. Einst war sie eine reiche Tabakstadt. Das ist vorbei. Sie hat aber einige historische Gebäude bewahren können, meist in einem schlechten Zustand. Auf einem der verfallenden Gebäude steht in Graffiti „Fuck Merkel“. So wird Geschichte geschrieben. Im Tabakmuseum erfährt R. einiges über die Geschichte der Stadt. Unterhält sich mit einer älteren Dame, die für das Museum arbeitet. Osmanisches soll man noch in einem Viertel unterhalb der Burg finden. Auf dem Weg dorthin begegnet ihm im Park ein alter Lautenspieler, auf einer kleinen Mauer sitzend, mit einem gelben Kästchen vor sich, für Spenden. Etwas weiter findet eine 1. Mai Demonstration der Kommunistischen Partei statt. Es mutet etwas anachronistisch an. R. macht Fotos. Dahinter ragt majestätisch ein altes Herrenhaus im Tudorstil auf, heute das Büro des Bürgermeisters. Es trägt die Aufschrift „diMARXeion“ (Rathaus)! Zur anderen Seite hin geht es zum Hafen, in dem neben kleinen Yachten Fischerboote liegen. Sie tragen das Wappen der autonomen Mönchsrepublik bzw. der griechisch orthodoxen Kirche. Gehören sie zu Berg Athos? R. geht durch das alte Burgviertel hinauf zur Burg und mäandert durch die engen Gassen bis zum Leuchtturm. Von dort hinab auf die Felsen. Überall Reste der Besucher. Bonbontüten, Plastikflaschen, Dosen, andere Verpackungen. Bunt. Fast schon eine Installation für Umweltverschmutzung. Einige der Felsen sind bemalt. Noch viel bunter ist die dunkelrosa angestrichene Moschee, deren Putz an vielen Stellen bröckelt und weiße Flecken hinterlässt. Auch andere Gebäude sind stark vernachlässigt und baufällig. Quer durch die Stadt führt ein altes Aquädukt, unter dessen Bögen kleine, halb verfallene, aus Stein und Holz gebaute Hütte aus vergangenen Tagen stehen.
Während des Zweiten Weltkriegs haben die Bulgaren die alte Tabakhalle im Auftrag der deutschen Nazis genutzt, um die Juden (1.500 von 1.650) der Stadt zusammenzutreiben und über Wien in das KZ Treblinka zu schicken. Sie starben dort. Egal, wo R. ist, die deutsche Geschichte holt ihn ein.
Abends fährt R. auf die Fähre über Limnos nach Lesbos. Sitzplatz über Nacht. Keine Kabine bekommen.








Tag 30; Donnerstag, 2. Mai 2024; Mytilini (Lesbos, Griechenland); 100km
Es ist früher Morgen, als R. auf Lesbos ankommt. Warum Lesbos? R. will sehen, was damals auf dem Höhepunkt der europäischen Flüchtlingskrise vor sich gegangen ist. Da R. erst mittags in das Zimmer kann, erkundet er den Süden der Insel. Die Route führt ihn durch Olivenhaine, an Stränden entlang und über kleinste Straßen durch das gebirgige Land. Auf dem Weg zurück nach Mytilini steuert er das Flüchtlingslager Moria an; eines von mehreren auf der Insel. Das Lager hatte eine Kapazität für 2.800 Flüchtlinge. Im Laufe des Jahres 2000 waren es 20.000, die sich dort aufhalten mussten. COVID kam dazu, Infizierte sollten isoliert werden. Die Stimmung schlug um. Im September des gleichen Jahres lösten einige afghanische Flüchtlingen – vielleicht aus Verzweiflung - einen Brand aus, der das gesamte Lager vernichtete. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Über Nacht wurden 12.600 Flüchtlinge obdachlos. Viele wurden dann auf das Festland gebracht.
R. wird am Eingang des nicht verschlossenen Lagers mit den Worten „Welcome to Europe“, das groß auf der Außenseite der Lagermauer steht, begrüßt. Im Eingangsbereich liegen Schutt und Gartenabfälle. Die Einheimischen nutzen das Gelände jetzt als wilde Mülldeponie. Nur die gemauerten Gebäude stehen noch. Die Mauern. Zum Teil. Von innen alles zerstört. Sanitäranlagen ohne Waschbecken und Toiletten. Pflanzen erobern Terrain zurück und wachsen aus der Kloschüssel. Ziegen springen durch die Tür-losen Räume und wieder heraus. Reste der Einrichtung liegen herum. Ein Paar Stiefel, als hätte sie jemand vor kurzem ausgezogen und hier vergessen. An einer gefliesten Wand steht auf Arabisch „ich habe aufgeräumt“. Verkohlte Bäume mit ihrer schwarz glänzenden Rinde zeugen noch von dem Feuer. An den Wänden der Hauptstraße verblassen Malereien von Kindern. Blumen, Gesichter, Herzen, Namen. Verblassen, verschwinden. Stacheldraht liegt überall herum. Kleidungsstücke haben sich darin verfangen. Sind zerrissen. Schuhe liegen verstreut auf dem Boden. Zwischen Trümmerteilen. Vom Gras allmählich verschluckt. Geschirr ist zerschlagen, wird überwuchert. Moria verschwindet, ist vielleicht schon aus den Köpfen der Menschen verschwunden. Narben sind geblieben.
Als R. an der Unterkunft in der Innenstadt, nahe dem Hafen ankommt, begrüßt ihn der Besitzer oder besser, der Sohn der Besitzerin, einer älteren Dame. Alle sprechen gut Englisch. Die Schwester der Besitzerin war 35 Jahre in Südafrika. Das Hotel war mal besser. Alles alt. Vieles nicht mehr in Benutzung. Die Lobby mit dem Frühstücksbereich reduziert auf einen Schreibtisch, einen Stuhl und ein Sofa. Es muss lange her sein, dass es hier einmal schön war.

















Tag 31; Freitag, 31. April 2024; Mytilini, orthodoxer Karfreitag
Karfreitag im orthodoxen Kalender. Ein ruhiger Tag. Den ganzen Tag bimmeln die Kirchenglocken. Langsam, alle paar Sekunden ein Schlag. Alles geht geruhsam zu. Gedenken an die Kreuzigung Jesu. R. nutzt die Gelegenheit und fotografiert die verlassenen Gassen. Nur wenige Geschäfte haben geöffnet, wie der Fischhändler, der R. einen abgezogenen Fisch entgegenhält. Ein alter Mann sitzt auf einem Stuhl vor einem Laden. Stiert vor sich hin. Im Hafen reparieren Fischer auf ihren Booten die grünen Netze. Viele der Häuser sind in einem desolaten Zustand. Künstler haben sich vieler dieser Häuser angenommen und die Wände mit schönen Bildern bemalt. Auch die kommunistische Partei nutzt die freien Flächen für ihre „Werbung“ gegen Kapitalismus und NATO. Am Hafen steht eine alte kreisrunde, an ein Ufo erinnernde Kongresshalle, deren Beton bröckelt. R. geht weiter, hoch zur Burg. Die ist heute geschlossen. Dahinter befindet sich ein kleiner Hafen mit Blick auf Industrieanlagen. Auf deren hohen Wänden steht: „Close Moria! Stop deportation.“ Ein Mann steht am Hafen und verkauft in riesigen, weißen Säcken Holzkohle von einem Pickup aus. In einem der Lokale isst R. zu Mittag. Fisch. Der Weg zurück führt durch ein älteres Stadtviertel mit einer Moschee, die mehr einer Ruine gleicht, denn einem lebendigen Gotteshaus. Einige Moslems gehen auf das Grundstück der Moschee und schauen sie sich an. R. auch. Daran schließt sich eine Gasse mit vielen kleinen Geschäften an. Manche haben geöffnet. Die Tür einer Schreinerei steht offen und als R. einen Blick hinein wirft, steht ein großer, angeleinter Hund auf dem Tisch und bellt ihn an. Foto.
In den Kirchen ist viel los. Die Gläubigen haben sich schick gemacht und gehen zu einem mit vielen Blumen geschmückten Tisch, auf dem eine Konstruktion steht, die symbolische das Grabestuch Christi enthält. Davor liegt das goldene Evangelium, das die Gläubigen küssen. In einer Kirche konnte R. sehen, wie eine ältere Frau durch das rote Tuch unter die einen Sarg symbolisierende Konstruktion kriecht. R. sah sie auch nach einiger Zeit nicht wieder herauskommen und geht.
In der Hauptkirche gibt es eine bewaffnete Ehrenwache des Militärs rechts und links von der angebeteten Konstruktion! Am Abend wird diese Konstruktion von Gläubigen Männern in einer großen Prozession durch die Stadt und anschließend wieder in die Kirche getragen. Am Eingang der Kirche wird die Konstruktion auf ein hohes Gestell gelegt, damit die Gläubigen darunter hindurch gehen und den stilisierten Sarg berühren können. Anschließend wird es unter ein silbernes Marienbildnis gestellt. Die Gottesmutter beweint ihren toten Sohn. Danach zerfleddern jugendliche Gläubige die Gebinde und verteilen die Blumen.
Eigentlich soll noch ein Lichterfest stattfinden, bei dem die Einwohner aller Stadtteile im Hafen mit Kerzen versehende Lampions steigen lassen. Ein Einwohnen sagt R., dass man das aufgegeben hat, da dadurch zu viele Brände in der Stadt ausgelöst wurden.
Im Hotel angekommen, spricht R. mit dem Wirt und fragt, wie es momentan mit Moria und den Flüchtlingen geht. Es ist ruhiger geworden. Keine Probleme mehr. Das noch bestehende andere Lager ist für besonders gefährdeten Personen. Die machen keinen Ärger. R. war zufällig am Vortag daran vorbeigekommen. Streng bewacht, aber die Flüchtlinge sind frei, es zu verlassen und um zum Beispiel einkaufen zu gehen.










Tag 32; Samstag , 4. Mai 2024; von Mytilini nach Ayvalik (Türkei); 180km
R. hat noch Zeit bis zur Abfahrt der Fähre am frühen Abend. So erkundet er den nördlichen und westlichen Teil der Insel und fährt nach Sigri zu den versteinerten Bäumen. Das Wetter ist abwechslungsreich und er erkennt zu spät den heftigen Regenschauer, der über das Land heruntergeht. Bevor er sich anziehen konnte, ist er komplett durchnässt. Die offene Landschaft ist meist nur spärlich bewaldet. Die schweren Wolken jagen über die Berge und die noch nicht ganz grünen Hänge. Regnen zwischendurch ab. Es ist kühl. Gehöfte und kleine Dörfer säumen R.s Weg. An den Ufern liegen kleine Fischerboote; die Häuser sind eher ärmlich. Manchmal leerstehende Fabrikgebäude, deren frühere Nutzung nicht mehr zu erkennen ist. In einem Dorf gibt es ein Lokal, das auch gleichzeitig Dorfladen ist. Dort hält R. an, um sich in die nun herauskommende Sonne in den Vorgarten des Gebäudes zu setzen und einen Kaffee zu trinken und ein Gebäckteil dazu zu essen. Im ganzen Nordwesten der Insel findet man versteinerte Bäume, die man auch in einem Museum betrachten kann. Im Ort findet R. am Hafen ein Restaurant, das geöffnet hat und in dem ein Touristenbus angehalten hat. Sie sind bereits mit dem Essen fertig und R. konnte einen Platz bekommen. Der Wirt fängt die Makrelen, die er serviert, im Hafen. Es regnet wieder; noch einen Kaffee und es hört auf. Einige der Straße auf seinen Umwegen zurück nach Mytilini enden bei kleinen Siedlungen am Meer. Umkehren.
Zurück in Mytilini. Hafengelände. Die Zollabfertigung ist problemlos. Die meistern kaufen noch etwas im Duty Free Shop ein. Alkohol und Zigaretten vor allem. Bei Auffahren auf die Fähre soll R. das Motorrad in eine Ecke des Decks stellen. Zwei Männer schieben, während der Motor noch läuft. Dabei kommen sie mit dem Hinterrad auf eine Bodenanker zur Befestigung von Fahrzeugen. R. verliert das Gleichgewicht. Das Motorrad legt sich auf die Seite. Der Motor heult auf. Alle schauen dem unfreiwilligen Spektakel interessiert zu. R. macht den Motor auf und die Männer sind verdutzt darüber, was gerade passiert ist. Sie stellen es wieder auf und R. geht peinlich berührt unter Deck. Dort sitzen Familien und kleine Gruppen oder ALlienreisende und essen ihre mitgebrachten Speisen. Es herrscht eine lockere Atmosphäre. Lachen, Kinder rennen.
Die Einreise dauert etwa eine Stunde. R. reist mit dem Personalausweis ein. Die Formalitäten dauern etwas und er ist einer der letzten, der dran ist. Koffer öffnen, ein paar Fragen beantworten. Danach in die Abfertigungshalle gehen. Passkontrolle, Weiter durch auf die anderen Seite und wieder heraus. Dort darauf warten, dass das Tor zu den Fahrzeugen geöffnet wird und zur Unterkunft fahren. Es ist schon dunkel. Das Navi schickt ihn über das miese Kopfsteinpflaster durch die komplette, ziemlich enge Altstadt, vorbei an kleinen Geschäften und Lokalen. Das Guesthaus ist ein geschmackvoll, frisch renoviertes, altes Gebäude. Das Motorrad steht in einer Seitenstraße vor dem Eingang des Hotels auf einem durch die Zeit und Wurzeln der benachbarten Bäume stark gewellten, löchrigem Kopfsteinpflaster. Nachdem er sich frisch gemacht hat, geht R. die Straße, wieder zurück zu den Restaurants. Aus einem kommt Mandolinenmusik. Er geht hinein und findet einen Platz in dem winzigen Lokal. Man teilt sein Essen, auch R. bestellt. Es wird viel Raki getrunken. Einige der Männer sind bereits stark angetrunken. Man unterhält sich, auch mit R. Mit zwei Anwältinnen aus Istanbul spricht R. länger. Ihr Reisebüro hat ihnen ein Fährticket für Sonntag nach Lesbos verkauft. Sonntags fährt keine Fähre. Der Musiker spielt Schlager und klassische türkische Lieder. Wie auch die anderen Gäste, gibt R. dem Musiker etwas Geld. Es wird viel geredet und getrunken. R. muss immer wieder Schnaps ablehnen, meist von den schon stark angeheiterten Gästen. Auf dem Rückweg durch die Gassen sieht R., wie schön die Stadt mal gewesen sein muss, als sie noch ausschließlich griechisch war, bedingt durch ein Edikt (Ferman) des Sultans im 18. Jahrhundert, das ausschließlich Griechen erlaubte, hier zu siedeln und ihren Bräuchen nachzugehen. Ayvalik bedeuten Quittengarten, auch wenn heute der Olivenanbau die Hauptaktivität ist.
Tag 33; Sonntag, 5. Mai 2024; Fahrt nach Pamukkale; 350km
Frühstück auf der Terrasse eines Lokals in der Altstadt. Kaffee und irgendetwas an Gebäck, was kein Fleisch enthält. Die Kommunikation ist schwierig. R.s Türkischkenntnisse müssen erst noch wachsen. Die Menschen hier sprechen kein Englisch. Nun gut, er ist satt geworden und gut war es auch, allerdings etwas trocken. Noch ein Orangensaft dazu und einen weiteren Kaffee. Zurück zur Unterkunft. Eine der zahllosen Katzen hat es sich auf dem Sitz des Motorrads gemütlich gemacht. Dort wohl geschlafen. Die Landschaft auf der Fahrt nach Pamukkale zeigt sich von seiner schönsten Seite. R. geniest sie. Die Straßen sind überraschend gut ausgebaut. Pamukkale ist ein Touristenhotspot. Die Kalkformationen zeihen unendlich viele Touristen an. R. findet einen Campingplatz oberhalb des Ortes mit Blick auf das Naturschauspiel. Er ist der einzige Camper, nur ein paar Gäste, Einheimische wahrscheinlich, sitzen an den Tischen unter den Bäumen. Essen und Trinken etwas; gehen. Die Anlage ist etwas heruntergekommen. Das Wirtschaftsgebäude, in dem auch die Besitzer wohnen, schäbig und die Sanitärräume sanierungsbedürftig. Es ist kalt. Sehr kalt. Es gibt keinen Aufenthaltsraum, nur die Stühle und Tische auf dem Rasen und auf der Terrasse. Dick eingepackt setzt R. sich hin und bestellt Abendessen. Nachts sinkt die Temperatur bis unter 5°C. R. friert die ganze Nacht über. Der Platz liegt auf etwa 1.500 Höhe.
Tag 34; Montag, 6. Mai 2024; Pamukkkale und Aphrodisias; 200km
Die Sinterrassen sehen aus wie Schnee und Eis. Es ist aber Kalk, der durch heiße Quellen (58°C), die sich über die Terrassen ergießen, ausfällt und die skurrilen Formationen bildet. Bereits den alten Griechen gefiel das und sie bauten oberhalb der Terrassen die Stadt Hierapolis. In den letzten Jahrzehnten wurde hier touristischer Schindluder getrieben und sogar eine Straße durch die Terrassen geschlagen, damit man mit dem Auto durchfahren konnte. Nun wurde alles gereinigt und die Pracht wieder hergestellt. Die Straße ist nun ein Fußweg. Was R. nicht ahnte, ist, dass man nur barfuß gehen darf. Also Motorradstiefel ausziehen und alles tragen. Es ist sehr warm geworden. Er geht den Terrassen bis zum Busparkplatz hoch. Auf dem Weg begegnet er vielen Leuten aus der Türkei und dem Rest der Welt. Auch gibt es viele Franzosen und vor allem Russen. Selfies und Fotos werden überall gemacht. Frau stellt sich in Pose und klick, das Bild für die Freunde ist fertig. In einem größeren Becken baden sogar einige BesucherInnen. Einige muslimische Frauen gehen an ihnen vorbei. Mit Kopftuch oder gar verschleiert. Kontraste. Unter dem einzigen Baum steht ein älteres Paar: der Mann mit Anzughose und hellblauem Hemd, die Frau in einem schwarzen Mantel und einem bunten Kopftuch. Sie suchen Schatten. Auf dem Rand einer Rinne mit seinem schnell fließenden und warmen Wasser sitzt eine Gruppe Männer und baden ihre Füße darin. Reden, telefonieren. Der Rand der kalk-weißen Rinne ist teilweise orange geworden und im Wasser wachsen grüne Algen. An anderer Stelle leuchtet das Wasser, das eine lange Furche gebildet hat, intensiv Smaragd-Grün.
R. trifft andere Motorradfahrer. Zwei Tschechen und einen Engländer, der, aus Südafrika kommend, auf dem Weg in seine Heimat ist.
In der Stadt versucht R. in verschiedenen Telefonläden eine türkische SIM-Karte zu bekommen. Leider ist niemand in der Lage, eine zu installieren. Selbst die Back-Office Unterstützung hat nichts gebracht. Erstaunlicherweise spricht niemand, auch die jüngeren Angestellten, ein Wort Englisch. Frustriert fährt R. weiter über die landschaftlich reizvolle Landstraße bis nach Aphrodisias, der Ausgrabungsstätte einer alten griechischen Stadt. Es gibt es noch eine Reihe antiker Gebäude, die gut erhalten sind. An einem Tempeleingang sitzt ein junges Paar und macht mit einer Drohe, die nur wenige Meter vor ihnen still in der Luft steht, Selfies. R. überlegt, ob das ein neuer Trend wird…
Zurück am Campingplatz angekommen, sind nun doch noch einige wenige weitere Gäste gekommen. Ein älteres Ehepaar aus Würzburg steht mit seinem originalgetreuen, gelben-orangem VW-Camperbus, der bereits 43 Jahre alt ist und über 300.000km runter haben soll (Tachowelle war jahrelang defekt), auf dem Platz. Sie unterhalten sich lange über ihre Reisen und ihre Pläne. Essen gemeinsam.













35. Tag, Dienstag, 7. Mai 2024; Fahrt nach Kaş
Lange Fahrt durch weite Hochtäler und Gebirge Richtung Süden an den Küstenort Kaş. Der wurde R. von den deutschen VW-Bus Fahrern aus Würzburg empfohlen. Mittags hält R. an der Hauptstraße in einem Schnellimbiss an. Es ist sehr warm geworden. Ganz anders als in Pamukkale. Eine junge Frau und ein ebenso junger Mann stehen hinter dem Tresen. R. bestellt Döner. Sie sehen, dass R. einen Fotoapparat hat und möchten fotografiert werden. Gerne erfüllt R. ihren Wunsch. Danach holt er seinen Miniprinter heraus und schenkt ihnen Ausdrucke. Sie freuen mich. R. auch.
Der terrassierte Campingplatz liegt direkt Meer, mit eigenem Restaurant, Bar, breitem Holzsteg zum Baden und vielen, schattenwerfenden Bäumen. Neben R. richtet sich eine französische Familie mit drei Kindern, darunter ein 15 Monate altes Kleinkind ein. Sie sind mit dem Fahrrad aus Frankreich gekommen. Sie werden 15 Monate mit ihren Rädern und dem Baby-Anhänger unterwegs sein. Ohne E-Motor. R. ist erstaunt über ihre Leistung. Sie sind jetzt auf dem Weg zurück nach Frankreich. Da zwei der Kinder schulpflichtig sind, unterrichten die Eltern sie. Das geht in Frankreich, nicht in Deutschland. Ob sie Wissen verpassen, kann R. nicht herausfinden. Das Lernen geht sehr entspannt zu, ebenso wie die Hausaufgaben. Neben ihnen steht ein kleiner, älterer Wohnwagen von einem türkischen Arzt aus Ankara. Er überhäuft R. und die Familie mit Essen und Trinken: Ayran für jeden. Aus Pappbechern (da hygienischer, sagt der Arzt. Er achtet extrem auf Hygiene und hat fast nur Einwegartikel). Als R. abends wieder an seinem Wohnwagen vorbeigeht, bietet er ihm Bohnen, eingelegte, scharfe Chilis, eine halbe Zitrone und gefüllte Weinblätter an, danach Pudding. Auf Einweggeschirr. R. versucht sich mit dem, was er hat, zu revanchieren. Eine Gurke ist alles, was er parat hat. Er will am nächsten Tag etwas besorgen. Von den verkohlten Köfte (Benzinkocher das erste Mal benutzt. R. muss noch besser werden) konnte er nichts anbieten.
Tag 36; Mittwoch, 8. Mai 2024, Kaş
Nach einer ruhigen, warmen Nacht und Frühstück geht R. über den Campingplatz, der sich am felsigen Ufer entlangzieht. An den Miethütten wachsen grell Magenta-farbige Bourgainlillea. Richtung Stadt liegt linkerhand ein Amphitheater, das R. besichtigt. Besucher gehen die steilen Ränge hinauf und wieder hinunter. Sitzen auf den Steinbänken. Auf der Bühne am Fuße der Treppen steht ein frisch vermähltes Paar, von dem Freunde Fotos machen. So auch R. Kaş besitzt zwei Häfen, einen neuen Yachthafen und den alten Fischerei- und Handelshafen. Im letzteren geht R. spazieren. Auf der hohen, mit schönen Graffitis versehenen Schutzmauer geht ein junges asiatisches Paar schnellen Schrittes Richtung Leuchtturm. Die Frau in einem langen weißen Kleid und mit Hut vorweg. Der Mann mit zwei Rucksäcken und einem Kaffee to go oder so folgt ihr auf den Schritt. Irgendwo in der kleinen Altstadt isst R. zu Mittag und geht für den Abend einkaufen. Dabei trifft er den türkischen Arzt vor einem Geschäft. Er hat bereits für beide eingekauft. Es wird viel zu Essen geben, da nun beide dafür gesorgt haben. Abends reicht das Essen dann auch noch für die französische Familie, die sich über unsere Einladung freut. Sie achten sehr auf das Geld und sind für jede Unterstützung dankbar. Der Vater ist extrem umsichtig und vorsichtig, dass den Kindern nichts passiert. Es wäre das Ende der Reise. Die Kinder gehorchen sogar und sind trotzdem sehr selbständig. Vorzeigefamilie. R. fragt sich, warum das bei ihnen anders gelaufen ist. Ist es das wirklich. Er weiß es nicht. Dazu muss man wohl von außen draufschauen. R. holt den Raki raus, den er gekauft hat. Die Familie verabschiedet sich dann und der Arzt holt aus einer Kühlbox, die mit kleinen Plastikflaschen gefüllt ist, zwei davon heraus und gibt sie R. Raki. Der Mann hat vorgesorgt.
37. Tag; Donnerstag, 9. Mai 2024; von Kaş nach Eğirdir; 340km.
Morgens spricht R. noch mit einem Wanderer aus Deutschland, der den lykischen Weg gegangen ist. Anscheinend endet der hier. Dieser Wanderweg ist sehr anspruchsvoll. Umso mehr erstaunt es R., wie viel Gepäck der Mann dabeihat. Neben Zelt und Kochgeschirr sogar einen bequemen Stuhl.
R. fährt dann an der schroffen, bezaubernden lykischen Küste nach Antalya, ohne dort anzuhalten. Die Hauptstraße führt durch die vielen Vororte, die durch hohe Wohnblocks, teils älter, teil in Bau befindlich, gekennzeichnet sind. Es geht dann weiter nach Norden mit Ziel Eğirdir am gleichnamigen See. Hier soll es schön sein. Unterwegs hält er an einem Moscheekomplex an, der einem Dorfzentrum ähnelt. Nicht groß, aber im gleichen Gebäude befindet sich ein Laden, mit Dingen des täglichen Lebens, wie Lebensmittel, Spielzeug, Gasflaschen. Daneben ein anderer Laden, der auch Eis und Getränke verkauft und vor dem Laden ein paar Tische aufgebaut hat, an denen R. eine Kleinigkeit zu Mittag essen kann. Weiter geht es dann über kleine Straßen durch die Berge. Je näher R. an Eğirdir kommt, desto mehr Landwirtschaft wird betrieben. Ein kleiner Fluss stillt den Wasserbedarf für die meist aus Obstplantagen bestehenden Pflanzungen. In der Stadt gibt es nur einen miserablen Campingplatz direkt am See, oder besser gesagt, dort, wo der See einmal war. Der Strand ist jetzt mindestens 100m weit entfernt. Der Sprungturm am felsigen Ufer ermöglicht es Badenden nicht mehr, direkt ins Wasser zu springen. Sie würden anstatt dessen auf den trockenen Felsen landen.
Auf dem Campingplatz stehen zwei weitere Kleinzelte und ein paar Wohnmobile, unter anderem Holländer und meine Bekannten aus Würzburg mit ihrem alten, gelb-orangem VW-Bus! Allseits Freude beim Wiedersehen! Sie empfehlen R. zu Fuß auf den Markt zu gehen. Er geht an der großen Kaserne und relativ neuen Wohnblöcken vorbei in die Stadt mit seiner alten Moschee und ein paar alten Häusern. Auf dem offenen Markt kauft R. ein paar Apfelsinen. Er bekommt von der Marktfrau noch eine sonderbare, kleine, orange Frucht geschenkt. R. vergisst aus lauter Freude zu bezahlen und geht. Erst zwei Reihen später fällt es ihm auf, eilt zurück, entschuldigt sich und bezahlt. Peinlich. R. geht zurück zum Campingplatz. Es ist fast dunkel und sehr kalt. Der Ort bietet nichts Interessantes. R. geht in ein Lokal gegenüber dem Campingplatz. Die Gäste und Besitzer sehen traditionell aus. Das Essen ist gut. Sie schenken keinen Alkohol aus. Da es hier nichts weiter, gibt, was R. interessiert, beschließt er, schon morgen weiterzufahren und nicht noch eine Nacht an diesem tristen Ort zu verbringen. Spät abends laufen jugendliche Mädchen und Jungen über den Campingplatz und werfen mit Eiern auf ein kleines Gebäude am Rand des Platzes. R. hofft, dass sie die Zelte in Ruhe lassen. Das tun sie.
38. Tag; Freitag, 10. Mai; Fahrt nach Konya; 310km.
Die Sanitäranlagen sind so heruntergekommen, dass es ein gehöriges Maß an Überwindung kostet, sie morgens zu benutzen. Daneben ist ein ungeheizter Aufenthaltsraum, der anscheinend nie gereinigt wird. Zumindest ist R. dort vor dem Wind geschützt und macht sich Frühstück. Schnell und ohne seine Sachen irgendwo auszubreiten. Zu schmutzig. Er trifft dort den Mann, der das kleine Zelt in seiner Nähe hat. Es ist ein rumänischer Wanderer, der Probleme mit seinem Arm hat.
R. fährt zuerst zum Aussichtspunkt oberhalb der Stadt und trinkt dort einen Kaffee. Die kleine, alte Siedlung um diesen Aussichtspinkt wirkt etwas lieblos. Gerümpel liegt herum. In einem zu einer Seite offenen Betonbau steht ein einsamer Sessel vor einer roten Wand und wartet darauf, einem Müden Ruhe zu geben.
Anschließend geht es nördlich um den See herum. Sieht dabei zwei kleine Kolonien von rosa Flamingos. Das gesamte Nordufer des Sees besteht aus Obstplantagen. Praktisch alle Bäume werden bewässert. Darin liegt die Erklärung für den drastisch gesunkenen Wasserspiegel des Sees. Die Natur kommt nach dem Menschen erst an zweiter Stelle. Aber was, wenn die Natur, der See, verschwindet. Dann gibt es auch keine Obstplantagen mehr. Kurzzeitiger Profit ist wichtiger als langfristigen Auskommen.
R. steuert Akşehir an, die Heimat des Nasreddin Hodja, dem kleinen Mann mit dem riesigen Turban und einem Esel. Seine Geschichten sind die des osmanischen Simplizissimus, Till Eulenspiegel, Don Quichotte, eines Alltagsphilosophen und Geschichtenerzählers. Einmal im Jahr findet hier ein Nasreddin Festival statt. R. hat beim Lesen seiner Geschichten oft Lachen müssen und über die Parallelen zu heute schmunzeln. Dieser Besuch ist daher ein Muss für R. Auf dem zentralen Platz der Stadt sind zahlreiche lebensgroße Bronzen aufgestellt, die die bekanntesten Geschichten darstellen. Auf der anderen Straßenseite befindet sich sein Grab in der Mitte des Friedhofs. Bei einem Spaziergang und auf der Suche nach einem Lokal entdeckt R. einen gut gepflegten Basar mit allerlei Geschäften. Ein Mann wartet am Straßenrand mit seiner Kutsche auf Kundschaft. Das Pferd ist mit einem roten Fes geschmückt, auf dem Türkiye steht und der Halbmond mit Stern aufgestickt ist. Rechts und links an der Montur hängen Bommel herunten. Ob’s dem Pferd genauso gut gefällt, wie den Touristen?
Es geht weiter nach Konya, der religiösen Hauptstadt der Türkei. Vorbei an einer alten Karawanserei, die zu einem Lokal umgebaut wurde. R. trinkt einen Tee. In Konya kommt er im Hotel Derya unter und parkt im Hinterhof, neben dem schon bekannten gelb-orangen VW-Bulli aus Würzburg! Es scheint in der Türkei nur eine Touristenroute zu geben, denkt sich R. beim Anblick des Fahrzeugs. Am Abend schlendert R. durch die Stadt und zur Moschee mit dem benachbartem, riesigen Kloster. Das Kloster hat bereits geschlossen. Auf dem Vorplatz befindet sich ein in grünes Licht gehüllter Brunnen für die religiöse Waschung vor dem Gebet. Moschee und Kloster sind hell erleuchtetet. Der neu-alte Basar grenzt daran an, nur durch eine Straße getrennt. Jetzt hat er bereits geschlossen und R. geht durch die verlassenen Gassen. Nur gelegentlich kommt ihm ein Mann entgegen. Große, beige, friedliche Hunde sind in der Mehrheit. Vor den heruntergelassenen Rollos stehen die Etageren, auf denen tagsüber die Waren ausgelegt sind.
39. Tag; Samstag, 11. Mai 2024; Konya; Stadt des Mevlana Ordens
Diese Millionenstadt ist das Zentrum des Mevlana Ordens, bekannt für seine tanzenden Derwische. Der Orden wurde hier gegründet und unter Atatürk verboten, da er sich nicht dem neuen Regime der Jungtürken unterordnen wollte. Das Zentralkloster wurde dann zum Museum. Trotzdem strahlt der Orden noch immer seinen Einfluss aus, zumindest was die Moral anbelangt. Politisch soll er anscheinend keine Macht mehr haben. Die Stadt ist stock-konservativ und man bekommt nur äußerst schwer Alkohol zu kaufen. Zu den Gottesdiensten rufen die Lautsprecher hier so energisch, dass R. Angst hat, sie würden gleich zerplatzen.
Am Vormittag besichtigt R. das Mevlana-Kloster. Viele Besucher, vor allem türkische Frauengruppen, sind in diesem reich geschmückten Kloster und fotografieren mit ihren Handys alles, was sie sehen. Ohne Unterschied, ohne erkennbaren Fokus. Jedoch bleiben die meisten am längsten vor dem Grab des Ordensgründer stehen. Sein Sarkophag ist mit einer schwarzen, mit weißen Ornamenten verzierten Decke verhüllt, auf der ein typischer Derwisch-Turban mit seinem zentral daraus ragenden, samt-braunen Konus, liegt. Auf den Verzierungen steht in goldenen Lettern ein Text. Im Park des Komplexes begegnet R. zwei Türken, die mit Ihren Sony-Kameras filmen. Sie kommen ins Gespräch und es stellt sich heraus, dass sie in der Medienbranche arbeiten. Sie tauschen Visitenkarten aus und machen ein gemeinsames Foto.
Auf dem Hot zwischen Kloster und Moschee spielen zwei Jungen Fußball. Die Moscheewand dient ihnen als Tor.
Auf dem Basar beobachtet R. die Menschen. Es regnet. Die Besitzer und die Käufer stellen sich unter, sitzen auf niedrigen Hockern, trinken Tee, reden miteinander. Friedlich. An einer Ecke des Basars gibt es noch ein großes Gebäude, in dem sich der Obst-und Gemüsemarkt befindet. Neben dem alten Basar entsteht eine neue Fußgängerzone mit Geschäften, Lokalen und Hotels. Klassisch zeitlos gehalten. Im Café Mystic genießt R. das beste Lokum, dass er je gegessen hat und kommt im Laufe des Tages dort wieder vorbei.
Auf der Hauptstraße, die durch die Stadt führt, gibt es eine Fahrrad-Demonstration. Es regnet in Strömen. Sie tragen die jordanische Flagge. R. kann nicht erkennen, worum es bei dieser Demo geht.
Den Abend verbringt er im Kulturzentrum der Stadt. Dort wird eine Derwisch-Vorführung gegeben. Viele Touristengruppen sind anwesend. Auch deutsche. Die Vorführung zeigt eine typische Tanz-Zeremonie. Beleuchtet in Weiß, Lila, Grün und Blau. Dabei stellen sich die Derwische in einer Reihe auf, der Chef als letztes. Sie gehen dann am Chef vorbei, grüßen sich und fangen an, sich zu drehen. Solange, bis sie aufhören, den Chef grüßen und sich wieder in Reih und Glied stellen.














40. Tag; Sonntag, 12. Mai 2024; Fahrt zur Ihlara-Schlucht; 280km.
R.s Plan ist, diesen Tag noch in Konya zu verbringen. Nach dem Frühstück führt ihn sein Weg zum Basar. Die Straßen sind leer. Die Rollos der Basarstände sind heruntergelassen. Nur die Hunde sind da. Heute ist Sonntag. Geschlossen. Etwas verblüfft kehrt R. in das Hotel zurück und storniert die Übernachtung. Neues Ziel: die Felsenklöster in der Ihlara-Schlucht. Auf einer gut ausgebauten, für R.s Gefühl überdimensionierten Straße geht es gen Osten mit erstem Halt an der riesigen Karawanserei Sultanhani, nicht weit vom Salzsee Tuz Gölü entfernt, den R. nicht besucht, da ihm seine Einzigartigkeit nicht klar ist. An der Karawanserei angekommen, bemerkt R., dass der Bügel seiner Brille abgebrochen ist. Vorsichtig packt er die Einzelteile ein und beschließt, nach der Besichtigung und einem Mittagessen, Sekundenkleber zu kaufen. Ein riesiges, wie zu einer Moschee führenden Tor mit zahlreichen Stuckverzierungen führt in den großen Innenhof, von Arkaden umrahmt, unter denen massive Sitzmöbel im orientalischen Stil zum Verweilen einladen. In der Mitte des Innenhofs befindet sich eine würfelartiges, nach allen Seiten offenes Gebäude, das an ein Gebetsstätte erinnert. R. geht durch dieses Gebäude zum hinteren Teil des Hofes, in das palastartige Innere der eigentlichen Karawanserei. Massive, hohe Pfeiler stützen das Dach und geben den Blick frei in diese ansonsten fast fensterlose Herberge für Karawanen. An den Säulen und Wänden des in warmem Licht gehaltenen Inneren sind kunstvoll gewebte Teppiche angebracht. Sie scheinen antik zu sein, sehen zumindest so aus; vielleicht aber auch aktuelles, meisterhaftes Kunsthandwerk. Zwischen den Säulen geht ein Brautpaar hindurch. Die Frau im langen, weißen Kleid hat ihre Augen stark geschminkt, fast wie Nofretete. Der Mann kommt im schwarzen Anzug daher. R. macht ein Foto, während die Braut ihren Kopf zum Mann neigt und ihn auf seiner Schulter ablegt. Viele Besuchergruppen drängen sich die immense Halle.
Anschließend geht R. in ein kleines Lokal, um etwas zu essen. Wieder Köfte. Mit Tomaten, Zwiebeln, Brot. Danach sucht R. einen Gemischtwarenladen auf, in dem er eine Tube SuperGlue kauft (Sekundenkleber; der Name kommt aus dem Französischen). Der Brillenbügel hält. Für’s erste.
Weiter geht es über kleine Straßen nach Ihlara, wo R. auf dem zentralen Platz den ihm schon gut bekannten gelb-orangen VW-Bus aus Würzburg sieht und kurz danach seine Besitzer. Sie sprechen darüber, wo man übernachten kann. Vom Camping raten die Franken ab, da es nachts sehr kalt werden soll. Sie haben ein mieses Zimmer im Ort gefunden. R. googelt und findet eine ansprechende Unterkunft ein paar Kilometer entfernt in Güzelyurt, einem kleinen Ort auf einem Berg. Mit großer Moschee und eben dem Hotel in einem Gebäude aus dem 16. Jdt. Das Zimmer ist stilvoll antik eingerichtet und es gibt einen großen Speisesaal. Das alles kostet. Viel. Über 60€. Es war früher mal die Behausung eines religiösen Ordens. Daher der große, jedoch fast menschenleere Speisesaal. Das Dorf selbst ist in einem eher schlechten Zustand. Die Läden in einer Art Basar sind entweder geschlossen oder verwahrlost. In einem offenstehenden Raum des Gebäudes liegt ein großer Haufen loser Weizen, daneben Säcke und ein kleiner Eimer, der zum Füller der Säcke genutzt wird. Man merkt, dass die Leute nicht viel Geld haben. Mitten im Dorf treibt ein Mann seine Schafe in den Stall. Die wollen nicht so recht und er muss sich Mühe geben, dass sie nicht wieder die Straße runter laufen.
Bei seinem Abendspaziergang kommt R. am Rand des Dorfes in die Ausläufer der Ihlara-Schlucht mit ihren Felsenhäusern und Felsenkirchen. Die Reste werden noch von den Bauern als Stallungen oder Scheunen benutzt. Sie sind von akutem Verfall bedroht. Einige der Häuser sind reich verziert und zeugen von einer einst besseren Zeit. Manche der Höhlen stehen offen und R. geht hinein. Die Gänge sind teilweise so eng, dass R. nicht hindurchkommt. Klein und feucht sind die Räume der Höhlenhäuser. Große, reich bemalte Räume findet er in anderen. Es sind Kirchen. Die Bevölkerung muss mal christlich, vielleicht griechisch, gewesen sein.
Beim Blick von einer höher gelegenen Stelle des Ortes sieht R. Minaretten der Moschee im Vordergrund und dahinter hohe, schneebedeckte Berge. Es ist der erloschene Vulkan Hasan Daği mit seinen 3.200m. Er erscheint R. zum Greifen nahe.
41. Tag; Montag, 13. Mai 2024; Güzelyurt und Ihlara-Schlucht; 50km
Morgens will R. in die Ihlara-Schlucht, um die alten orthodoxen Höhlenkirchen zu besichtigen. Als er das Hotel verlässt, sieht er auf dem Platz in der Nähe des Hotels den Wochenmarkt. Da muss er hin und sich anschauen, was so los ist. Er nimmt seinen Fotoapparat mit macht ein paar Bilder. Dabei kommt er mit einigen Leuten ins (Google-Translator-) Gespräch. Sie posieren für ihn. Nach einer Weile geht er zurück ins Hotel und druckt die Bilder für die Leute aus. Er bringt sie ihnen. Sie freuen sich darüber.
Nun fährt er weiter nach Ihlara, um in die Schlucht zu gehen. Jedoch ist die Zufahrt zum Parkplatz wegen Bauarbeiten gesperrt und R. muss an anderer Stelle in die Schlucht hinabsteigen. Er besorgt sich auf dem Hauptplatz noch schnell ein Kebab-Brot als Wegzehrung. Der Junge, der ihn bedient, spricht etwas Englisch und freut sich, das zeigen zu können. R. lobt ihn für seine Bemühungen. Am Taleinstige sitzt ein altes Ehepaar und verkauft getrocknetes Obst. R. kauft Feigen. Im Tal ist dann deutlich wärmer als oben. R. schwitzt und klemmt sich die Motorradjacke unter den Arm. Nach einer Weile setzt R. sich auf eine Bank und holt sein „casse croûte“ raus. Auf dem schmalen, etwa 5km langem Weg am Bach entlang begegnen R. einige Wanderer und Besucher. Am Ende wechselt R. die Seite des Bachs für den Rückweg, nachdem er in einem „Biergarten“ Kaffee getrunken hat. Dort laufen Hühner, Enten und anderes Vogelvieh zwischen den auf Stelzen stehenden Pavillons umher und suchen nach Fressbarem.
Es gibt im ganzen Tal Höhlenkirchen, die teilweise restauriert sind, teilweise jedoch in einem erbärmlichen Zustand. Manche davon wurden schon vor Jahrhunderten durch Christen selbst während des Bildersturms zerstört. Der Weggang der Christen vor hundert Jahren ließ die Kirchen verfallen und die Menschen hier haben auch ihr Übriges dazu beigetragen, dass die Schäden immer größer wurden. R. begegnet einem älteren deutschen Ehepaar mit Fahrrädern. Der Weg geht jedoch teilweise über Felsenstufen und durch unwegsames Gelände. Sie drehen um und nehmen die andere Seite, die einfacher zu bewerkstelligen ist. Auf dem Weg liegt auch eine kleine Moschee aus grünen Brettern zusammengeschustert und an die Felswand gepresst. Erstaunlich. Vielleicht eine Art Trotzreaktion angesichts der vielen Kirchen in Tal. An einer Stelle muss R. den Bach auf einem umgestürzten Baum überwinden, an dem jemand notdürftig ein Geländer angebracht hat. Dort trifft er auf eine amerikanische Touristin, die ihm in Tal schon mehrfach begegnet ist. Sie tauschen sich kurz aus und gehen dann ihrer Wege. R. trifft die Amerikanerin am Ausgang der Schlucht in einem Café. Sie setzt sich zu ihm und sie unterhalten sich. Am Nachbartisch macht ein türkisches Ehepaar auf sich aufmerksam und sie kommen ins Gespräch. Der Mann hat jahrzehntelang in Deutschland gearbeitet. Seine Familie und seine Frau stammen von einer sehr alten christlichen Gemeinschaft ab, die erst spät islamisiert wurde. Seine Frau ist blond und hat blaue Augen. Sie kommen aus einer Gegend an der georgischen Grenze und sind gerade dorthin unterwegs. Wir trinken Apfeltee. Der schmeckt erstaunlich gut.
Als R. am Hotel ankommt, macht er auch Bilder vom Personal und schenkt ihnen Ausdrucke. Abendessen im großen Speisesaal des Hotels. Ein paar wenige Tische sind besetzt. Es gibt nur zwei Gerichte zur Auswahl. Köfte oder Kebab…














42. Tag; Dienstag, 14. Mai 2024; Fahrt nach Göreme (Kappadokien); 230km.
Unterirdische Städte gibt es in dieser Gegend überall. Das weiche Gestein bietet ein einfaches Material, um Häuser und Kirchen in die Felsen zu schlagen. R. ist auf dem Weg nach Gaziemir, wo laut Reiseführer eine unterirdische Stadt zu besichtigen sei. Es ist ein winziges Dorf, in dem jemand vor Jahrzehnten bei Graben zufällig auf die unterirdische Stadt gestoßen ist. Diese Städte waren bis zu acht Stockwerke tief und konnten tausende Einwohner beherbergen. Sie wurden auch als Verstecke genutzt. Mit dem Wegzug der Griechen vor gut 100 Jahren gerieten diese Orte in Vergessenheit oder wurden bewusst getarnt, da man ja bald wiederkommen wollte. Das erinnert R. an seine eigene Familie, die aus dem damaligen Ost- und Westpreußen geflohen ist und lange dachten, sie könnten wieder zurückkehren. Die Geschichte verlief anders. Wie so oft.
Da R. nicht wusste, wie man durch das Eisengitter kommt, hat er sich erst einmal zu den etwa 20 einheimischen Männern in die nahe Teestube gesetzt und Tee getrunken. Ali, einer der Älteren, spricht Deutsch, da er in Düsseldorf gearbeitet hat. Sein Sohn lebt noch immer dort. Manchmal reist er hin. Wir haben Telefonnummern ausgetauscht für den Fall, dass er mal in der Gegend von Nürnberg ist. Da die verborgene Stadt durch ein eisernes Tor versperrt ist, kann keiner R. helfen. Jedoch gibt einen breiten Spalt neben dem Gitter. So zwängt sich R. durch und geht in den dunklen Untergrund. Überall Müll. Anscheinend gehen auch Jugendliche hier häufiger rein und essen Chips, trinken Cola und machen den Quatsch, den jungen Leute nicht lassen können. Er geht, mit seiner Stirnlappe bewaffnet, durch einige der Gänge, wagt es aber nicht, tiefer in den Untergrund zu gehen. Es ist stockduster, die Lampen sind aus und die Räume leer. Nichts Interessantes zu sehen. R. beschließt, aus dem Untergrund wieder ans Tageslicht zu gehen und zwängt sich wieder durch den engen Spalt neben dem eisernen Tor. Er verabschiedet sich von den Männern im Café und reist weiter. Nach Niğde. Es ist kalt und er kauft sich eine Mütze. Geht Essen. Köfte oder so, mit Gemüse und Brot. Dazu eine Çorba, eine Gemüsesuppe. Die gibt es auch als Schafkopfsuppe mit Hirn. R. achtet darauf, dass es die Gemüsesuppe ist. Im nahegelegenen Gümüsler gibt es ein unterirdisches Kloster, dass R. ansteuert.
Aus dem felsigen Boden ist ein riesiger, mehrere Stockwerke tiefer, quaderförmiger Innenhof herausgeschlagen worden. Von dort gehen in alle Richtungen Gänge und Räume, die man besichtigen kann. R. geht weiter nach unten, bis die Gänge so eng werden, dass er nicht mehr durchkommt. Früher müssen die Menschen kleiner gewesen sein. Oder schlanker. An einigen Wänden, die wohl zu den Kultstätten gehörten, sind christliche Wandmalereien zu sehen. Meist nicht restauriert und somit in einem schlechten Zustand. Ein paar wenige Besucher sind da. Nicht viele. Gegenüber dem Eingang trinkt R. dann in einem Lokal noch etwas und fährt durch eine große Ebene mit Schafhirten und Feldwirtschaft – natürlich bewässert. Dahinter tun sich schneebedeckten Bergen auf und berenzen den ansonsten weiten Horizont der mageren Ebene.
Der Campingplatz in Göreme ist heute sein Ziel. DAS touristischen Zentrum Kappadokiens.











43. Tag; Mittwoch, 15. Mai; Göreme und seine Montgolfièren
Auf dem „Panorama“-Campingplatz befindet sich R. in der ersten Reihe, in der Loge sozusagen. Bewusst wird ihm das gegen 6 Uhr morgens, nach einer eiskalten Nacht im Zelt. Trotz mehrerer Schichten Kleidung im Schlafsack hat er vor Kälte kein Auge zugemacht. Gefroren bis in die Knochen. Dann dieser Lärm. Ein tiefes Brummen zuerst, dann ein Fauchen. R. kann sich nicht erklären, woher diese Geräusche kommen. Er schält sich aus dem Schlafsack, dann kriecht er noch schlaftrunken aus dem Zelt und sieht direkt über sich riesige, bunte, mit großen Gondeln voller Menschen, besetzte Heißluftballon, die zwischendurch immer wieder den Brenner zünden, um an Höhe zu gewinnen. R. kann sie fast berühren. Sieht die Gesichter der eng zusammengepferchten Fahrgäste. Mit der Kamera bewaffnet, geht R. über den Platz und entdeckt eine ganze Reihe von Campern, die bereits am Rande des Hügels stehen, auf dem sich der Campingplatz befindet. Sie schauen, fotografieren, filmen, trinken Kaffee, unterhalten sich. Welch ein Schauspiel. Es ist, wie in den Reiseführern beschrieben. Dutzende Ballons fahren über ihnen hinweg. Manche winken den Campern zu, andere machen Selfies. Viele Asiaten dabei.
Nach dem Frühstück runter in den Ort, etwas zu Essen kaufen. Es gibt fast keine Lebensmittelläden, nur Unmengen an Souvenirläden und Agenturen, die Ballonfahrten (200-250€) und Offroadtouren verkaufen. Geldautomaten stehen schön aufgereiht nebeneinander auf dem Busbahnhof. Bestimmt 10 davon, davon kleine Warteschlangen. R. braucht Geld und probiert verschiedene Automaten aus, um zu sehen, was das kostet. 8-9% Gebühren werden verlangt, dazu Visa-Gebühren! Ein lohnendes Geschäft. Nachdem R. in dem einzigen Supermarkt etwas zu Essen gefunden hat – magere Auswahl -, geht er noch durch den Ort, der eigentlich nur aus zwei Straßen besteht. Eine davon bietet den Touristen lediglich Restaurants an. Freundlich bitten die vor ihnen stehenden Herren potenzielle Kunden in das Lokal. Am Ende der Straße gibt es noch einen Obst- und Gemüsemarkt, wo R. Trockenobst kauft. Ohne den Tourismus gäbe es diesen Ort wohl nicht.
Später, nachdem er sich etwas orientiert hat, geht R. in das Freilichtmuseum am Ende einer nahen Schlucht. Wie alle interessanten Museen, ist auch dies hier für ausländische Touristen seht teuer. Sie kosten alle etwa 20€ Eintritt. Hier muss man sogar noch für einzelne besondere Sehenswürdigkeiten zusätzlichen Eintritt zahlen! Hier kann man vielen Höhlenkirchen besichtigen, die teilweise restauriert sind. Fotografieren ist in diesen Kirchen verboten. Manchmal achten die Wärter darauf, manchmal schauen sie bewusst weg, manchmal halten sie verstohlen ihre Hand auf. R. wird mutiger, was das Fotografieren anbelangt, und geht in die „Dark Church“ (plus 6€ Zusatzeintritt) und fliegt bereits nach dem ersten Foto raus: „Out! Out!“ ruft der Wärter… Das ist das erste Mal, das R. aus einem Museum, einer Kirche, fliegt. Nun gut. Einen Versuch war es wert.
Für den Rückweg wählt er ein kleines Seitental, in dem sich auch eine Reihe von Wohnhöhlen und Kapellen befinden. Es sind nur noch Reste sichtbar. Das Gestein ist empfindlich und verwittert schnell. Das Tal aus weichem, weiß-leuchtendem Tuffstein wird an manchen Stellen so eng, dass er sich fast durchzwängen und über etliche Felsbrocken klettern muss.
Zurück auf dem Campingplatz angekommen, sind neue Gäste zu sehen. Ein Pärchen hat ein Wohnmobil, das R. interessiert. Ein Hymer Grand Canyon S. Ein solches, allerdings in einer neuen Version, haben R. und seine Frau auch bestellt. So gibt es viele Gesprächsthemen, die er mit den Besitzern aus Bayern führt. Abends essen sie gemeinsam und schauen dabei über die kappadokische Felsenlandschaft mit ihren Feenkaminen aus Tuffstein. Wie im Reiseführer. Manchmal ist die Realität unglaublich kitschig.
















Tag 44; Donnerstag, 16. Mai 2024; Göreme
An ein langes Schlafen ist nicht zu denken. R. wird wieder durch die Montgolfièren geweckt und nutzt die Zeit für atemberaubende Fotos. Es ist noch fast dunkel, als er das Zelt verlässt und sich zu den anderen gesellt. Es ist Sonnenaufgang schauen, nur, dass viele Sonnen in Form von bunten Ballons aufgehen. Jeder Gasstoß lässt sie in hell aufleuchten.
Irgendwann merkt R., dass er seinen Bauchgurt mit dem Portemonnaie (gestern erst Geld geholt) und allen wichtigen Papieren nicht wiederfinden kann. Leicht panikartig fragt er andere Camper, die sofort alle anderen mobilisieren. Einer von ihnen hat am Abend vorher den Bauchgurt im Duschbereich am Wandhaken gesehen. Keiner jedoch hat ihn. Er beschließt, zum Besitzer zu gehen und ihn zu fragen. Für den ist es jedoch noch zu früh. Nichts rührt sich in seiner Hütte hinter dem Zaun. Dann trifft er den Mitarbeiter, der den Platz in Schuss hält. Er hat den Gurt gefunden und aufbewahrt. R. ist sichtlich erleichtert und gibt ihm einen großzügigen Finderlohn. Der wiedergefundene Bauchgurt spricht sich in Windeseile auf dem Platz herum. R. sagt sich, dass er in Zukunft besser aufpassen muss!
Nach dem Frühstück macht er sich auf den Weg in das „Love“-Tal zu den phallusartigen Feenkaminen. Erstaunlich, was die Natur produzieren kann. 20-30m hohe, schlanke Türme mit einer Haube darauf stehen in diesem Tal. In einem kleinen, aus Brettern zusammengebauten Kaffee trinkt R. einen Tee und isst eine absolut leckere Çorba mit Brot. So gestärkt, geht es weiter zum Ende des Tals, durch ein spärlich mit Wasser gefülltes Bachbett und über die strahlend weißen und weich geschwungenen Felsen zurück auf das Hochplateau. An der belebten Straße geht es dann zurück zum Zelt. Mittlerweise sind auch andere Motorradfahrer eingetroffen: ein Hesse auf einer Ténéré 700 auf dem Weg nach Wladiwostok und ein Bikerpaar aus Polen, das eine Türkeirundfahrt machen. Alle drei sind erfahrene Weltreisende. Ihre Devise ist so simpel wie überzeugend: einfach losfahren; alles andere ergibt sich dann. Der Hesse, Sascha, schläft in einer riesigen Hängematte.













45. Tag, Freitag, 17. Mai; Fahrt nach Kahramanmaraş; 310km
Um nicht wieder von den Ballons geweckt zu werden, steht R. bereits um 5 Uhr auf. Es ist noch weitgehend dunkel. Andere sind auch schon wach und stehen am Rand des Plateaus, um zu beobachten, wie die Ballons gefüllt werden und langsam in den Himmel emporsteigen. In einem der Ballons, die über den Zeltplatz hinwegfliegen, ist die Motorrad-fahrende Polin, die gestern mit ihrem Mann angekommen ist. Sie ist nicht zu sehen. Später berichtet sie im Kreis der Motorradfahrer von ihrem Erlebnis, das sie sichtlich genossen hat.
Die Fahrt führt R. über eine teils öde, teils von spärlicher Landwirtschaft geprägten Hochebene, die dann in ein bergiges Gelände übergeht. Zwischendurch hält er an einer Raststätte mit einem riesigen, einfach gehaltenen Speisesaal an. An den Vitrinen wählt er sein Essen und beobachtet die Kinder, die – anscheinend zur Familie gehörend – durch die Halle laufen oder etwas tun. Auch sie beobachten ihrerseits R. Neugierde scheint sie zu ergreifen. Nach dem Essen steht R. noch draußen am Motorrad, als sich eines der Kinder interessiert dazustellt. Die Mutter steht dabei. Vor der Eingangstür des Restaurants. R. hebt das Kind auf das Motorrad und macht ein Bild und schenkt dem Kind einen Ausdruck. Es läuft sofort in den Speisesaal und holt die anderen Kinder. Nun will jedes Kind sein Bild haben und bekommt es auch, auf dem Motorrad sitzend. Anschließend sitzen vier Kinder zusammen auf der BMW und zwei stehen für ein Gruppenbild daneben. Zu guter Letzt kommen noch zwei Männer, die dort arbeiten, dazu und R. fotografiert auch sie. Eine bleibende Erinnerung.
Die Unterkunft in Kahramanmaraş ist so billig wie schlecht. Toilette und Bad nicht wirklich gereinigt. Das Bett gleicht einer Hängematte.
Spaziergang durch die von einem Erdbeben im letzten Jahr massiv zerstörten Stadt. Ruinen ragen in den Himmel, unfertige Neubauten auch. Bagger stehen auf dem Schutt eingestürzter Gebäude. Nach außen offene Treppenhäuser führen in die Etagen. Leere Ladenzeilen ohne Fensterfronten und mit Müll gefüllte ehemalige Verkaufsräume säumen die Straßenzüge. Kopftuchtragende Frauen gehen mit schweren Einkaufstüten durch Trümmerfelder, als wäre die Stadt bombardiert worden. Hohe Zäune sind um die aufgeräumten Stadtviertel gezogen. Große, bunte Plakate darauf zeigen, was jetzt und in naher Zukunft dort entsteht. Neue Stadtteile werden hochgezogen. Wohnungen, zu teuer für viele der ehemaligen Bewohner diese zerstörten Stadtteile, wie R. von einem Mann erfährt, den er darauf angesprochen hat. In fünf Jahren soll die Stadt wieder komplett aufgebaut sein. Die 5.000 Tote wird es nicht vergessen machen. Etwas weiter vom Zentrum leben die Menschen noch in den Trümmern. Auf einem Platz ist ein riesiges, hoffnungs-grünes Zelt aufgebaut, vor dessen Eingang ein einsamen Paar Latschen steht. R. begegnet dort nur wenigen Menschen, die geschäftig unterwegs sind. Ein Haus wird traditionell aus Naturstein wieder aufgebaut. Der Mauerer lässt sich von R. fotografieren. Ebenso ein Junge, der ihm ein Peace-Zeichen mit beiden Händen macht. Man arrangiert sich. Was bleibt ihnen ansonsten übrig, denkt R.




















46. Tag, Samstag, 18. Mai 2024; Kahramanmaraş
Der Basar der Stadt muss grandios gewesen sein. Große Teile des Basars sind wegen der Zerstörung durch das Beben noch abgesperrt. R. geht lange durch die trotzdem noch vielen geschäftigen Gänge. Viele Menschen sind hier unterwegs. Ein Ballonverkäufer sitzt starr auf seinem Hocker und wartet auf Kundschaft. Ein Mann mit bunter Tracht und eine riesige Kanne auf dem Rücken verkauft ein Getränk, dass er in Gläser füllt. Er sieht, dass R. sich für ihn interessiert. Er möchte wissen, was in der Kanne ist. „Türkische Kola“ gibt der Verkäufer als Antwort. R. probiert das süße Getränk und bedankt sich. Macht ein Foto. Er kann nicht identifizieren, was er da getrunken hat. Er wird sich später daran erinnern. Gleich neben dem Basar befindet sich das Handwerkerviertel, das anmutet, als stamme es noch aus dem 19. Jahrhundert. Schmale Gassen mit Werkstätten zu beiden Seiten. Die Handwerker sitzen zum Teil vor ihrer Werkstatt und arbeiten dort, beobachtet von Kunden. Es ist sehr laut, da hier Kessel und andere Metallbehältnisse hergestellt werden. Überall klopft und hämmert es. Ohrenbetäubend. Jeder Arbeitsschritt wird von einem anderen Handwerker ausgeführt: einer treibt aus einem Metallzylinder ein Gefäß, ein anderer heftet die Hankel daran, ein dritter verziert es mit kleinen Hammerschlägen und der nächste verzinnt es. Hier werden neben den Töpfen auch Messer hergestellt, Filzkleidung, Werkzeuge, Sättel, Holzwaren und vieles mehr. Alles ist Handarbeit.
Pause im Teehaus (Çay evi). Männer (nie Frauen) sitzen zusammen, trinken Tee und spielen Backgammon. Händler vom Gemüse- und Obstmarkt, der sich an der Außenseite des Basars befindet, kommen hier her und haben ihr eigenes Essen dabei. Sie reden, teilen ihr Essen untereinander und lassen auch R. etwas zukommen. Brot und gefüllte Weinblätter. Er bedankt sich bei dem Spender. R. kauft sich anschließend noch Trockenobst und Nüsse vom Markt.
Abends geht es zurück zur Unterkunft am Stadtrand. Er muss sie beeilen. Die Gedärme rumoren. Er schafft es gerade noch so auf sein Zimmer. R. vermutet die türkische Kola als Übeltäter. Dann Essen gehen in einer nahe gelegenen Köfteria. Dort wieder aufs Klo. Er kommt mit den jungen Verkäufern ins Gespräch, die von einem besseren Leben im Ausland träumen. R. fotografiert sie und gibt ihnen die Abzüge. Einer der jungen Männer möchte R. unbedingt etwas geben. Er schenkt ihm seinen Druckbleistift. R. ist gerührt.









47. Tag; Sonntag, 19. Mai 2024; Fahrt zum Götterberg Nemrut Daği; 250km
Mit etwas unwohlem Gefühl im Bauch fährt R. los. Toilettenpapier in Reichweite. Sicherheitshalber. Auch heute führt ihn der Weg weiter durch die gebirgige Hochebene, vorbei an kleineren Feldern und einigen bewässerten Obstplantagen. Zwischendurch dann eher Ödnis. Mittags an Trucker-Raststätte angehalten. Essen. Toilette. Es ist noch nicht zu Ende. Später wird die Gegend wieder attraktiver mit alten Brücken und Burgen. Bemerkenswert ist die Cendere Brücke über den Chabinas. 1.800 Jahre hatte sie gehalten, bis ein zu schwerer LKW sie zum Einsturz brachte. 1998 wurde sie renoviert und eine zusätzliche Brücke für den Schwerlastverkehr nur ein paar Hundert Meter weiter erreichtet. R. parkt gleich neben der Brücke auf dem Park- und Barbecue-Platz und geht unter die Brücke, wo schon einige Leute bis zu den Knien im flachen Wasser umherstaken. Kinder baden. Eltern schauen zu und freuen sich. Hinter der Brücke eine wilde Kluft mit steil aufragenden Felswänden, hinten denen der Fluss nach einer Biegung verschwindet. R. unterhält sich mit den Menschen im Wasser. Mit seinen Motorradstiefeln schafft er es bis zu einer Kiesbank in der Mitte, von wo aus er ein paar Fotos vom Brückenbogen macht. Oben auf der Brücke kommt er mit drei Jugendlichen ins Gespräch, die unbedingt von R. fotografiert werden wollten. Sie posieren vor den Säulen und R. schickt ihnen die Fotos per WhatsApp. Er überquert den Fluss mit einem Motorrad auf der neuen Brücke und begegnet ein paar Minuten später einem jungen türkischen Motorradfahrer, der seine Maschine am Straßenrand abgestellt hat, um mitten auf der Fahrbahn sein Stativ mit einem Handy darauf aufzubauen. Auch R. macht ein Fotos. Von ihm. Von der sich in die Ferne windende Straße. Kurze Zeit später überquert R. den aufgestauten Euphrat und befindet sich somit in Mesopotamien! Jetzt schon, denkt sich R.? Für ihn liegen Euphrat und Tigris in Iran und Irak. Er studiert die Karte und stellt seinen Fehler fest. Beide entspringen in der Türkei! Dann geht es dem Navi nach Richtung Nemrut Daği. Die Straße wird immer schlechter und schließlich schmal, steil, kaputt. 1. Und 2. Gang sind angesagt. Mehr geht nicht. Er kommt durch ein winziges Dorf und fragt sich, ob er hier richtig ist. Zum Schluss ist es ein mieser Schotterweg im Gebirge, der erst kurz vor dem Ziel wieder zu einer relativ neuen, gepflasterten Straße wird, auf der auch Reisebusse fahren. R. hat mal wieder eine Zufallsherausforderung gemeistert. Die alte Bergstraße zum Götterberg. Den Göttern sei Dank für diese Challenge! Auf dem Berg kann R. direkt vor dem Museum/Restaurant parken mit einem grandiosen Blick auf die umliegende Landschaft. Dort trifft er auch das polnische Bikerpärchen wieder, Edward und seine Frau. Sie sind aber bereits dabei, sich für die Abfahrt fertig zu machen. R. wird in dem Gebäude gegen eine geringe Gebühr auf einer der großen Sofas übernachten. Zuerst geht er aber hoch zu den Götterstatuen. Besser gesagt, er darf die zwei Kilometer bis zur Anlage mit dem Motorrad fahren. Anschließend geht er zu Fuß weiter über die Treppen nach oben. Vor 2.000 Jahren haben die Menschen hier sich die Mühe gemacht (oder mussten die Qual auf sich nehmen), ein Plateau zu schaffen und darauf einen Schotterhügel aufzuschütten. Per Hand, versteht sich. Gewaltige Konterfeis von Göttern und solchen Menschen, die welche sein wollten, stehen hier zusammen und blicken entweder gen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Meist sind Männer mit Bärten und Mützen abgebildet. Auch R. hat Bart und Mütze. Die Köpfe der eigentlich sitzenden Statuen sind nicht mehr auf ihren Körpern, sondern wurden ein Stück davor aufgestellt. Kopflos und körperlos. Zum mittelmäßigen Sonnenuntergang finden sich etwa 100 Menschen ein, sitzen und frieren im kalten Wind auf diesem historischen, künstlich aufgeschütteten Berg. Schauen nach Westen bis es fast dunkel ist und gehen zu ihren Kleinbussen. Fahren wieder. Nur wenige, wie R., bleiben in dem Gebäude, dass 24/7 geöffnet hat. Er ist dort zu Abend und legt sich schlafen. Wie auch die Angestellten, die ebenfalls auf den Sofas übernachten. Da das Licht nicht vollständig gelöst wird und immer etwas los ist, macht R. zu Anfang kein Auge zu. Die Nacht wird kurz.







48. Tag; Montag, 20. Mai 2024; Fahrt nach Şanliurfa; 200km.
Um 4Uhr30 geht das Licht in der Halle des Museumsgebäudes an. Der Tag beginnt hier und jetzt. R. wacht auf. Gerädert. Die ersten Besucher kommen bereits zum Sonnenaufgang. Er ist zu müde dafür. Waschen gehen, frühstücken. Sachen packen. Losfahren. R.s Plan ist, auf der anderen Seite des Berges wieder hinunterzufahren. Ein Mitarbeiter sagt ihm, dass das nicht geht, da es keine Verbindung zwischen den beiden Straßen gibt, die hoch zum Gipfel führen. Den Weg zurück nimmt R. dann auf der neuen Straße in Angriff. Überall liegt noch die nächtliche Ruhe wie ein Kissen auf den Ortschaften. Nur vereinzelt trifft er auf Menschen. Als die Gegend flacher wird, tauchen neben der Straße offene Tierställe auf, deren Dachkonstruktion wie Spieße in den Himmel ragen und über die im Winter wohl Planen gezogen werden. Vielerorts sind Zeltbehausungen zu sehen. Manchmal in der Landschaf. Manchmal am Ortrand. Es sind Wanderarbeiter, die jetzt auf den Feldern arbeiten. Hier ist viel „Verkehr“ auf der Straße: ein Mann kommt ihm auf einen schwer bepackten Esel reitend entgegen und lächelt ihm für das Foto zu. Dahinter eine Schafherde und ein zweiter Esel-Cowboy. Etwas später Kühe, Ziegen, Hühner. Ursprünglich. Alltäglich.
R. fährt zur Ausgrabungsstätte Göbeklitepe mit seinen viele Jahrtausende alten und mit Symbolen versehenen, in Kreisen stehenden Steinstelen. Vom Museum bis zur Ausgrabungsstätte ist es fast ein Kilometer. R. nimmt den Shuttle. Den falschen Shuttle. Dieser hier fährt in die 30 Minuten entfernte Stadt. Als R. das begreift, ist es zu spät. Also Şanliurfa, bzw. das große, zu den Ausgrabungen gehörige Museum, besichtigen. Die Rückfahrt ist etwas komplizierter, da R. zwischendurch umsteigen muss. Die Fahrgäste helfen ihm, eine Fahrkarte zu bekommen. Dafür braucht man normalerweise einen Account. Eine Frau schenkt ihm aber ein Ticket. Wieder an der Ausgrabungsstätte angelangt, steht neben R.s Moped ein ihm bekanntes. Eine Ténéré 700. Sascha ist auch da. Sie trinken an einem Imbisswagen (in Deutschland würde man Food Truck sagen), der auch Tische aufgestellt hat, etwas, bevor sie gemeinsam die Ausgrabung besichtigen. Im Vergleich zur naturgetreuen Nachbildung im Museum ist diese Anlage deutlich größer, da es nicht nur einen Steinkreis, sondern gleich mehrere gibt. Auf den Stelen erkennen sie Menschen- und Tierdarstellungen. Es war wohl eine 10-11.000 Jahre alte Kultstätte. Dann fahren sie ihrer eigenen Wege.
In Şanliurfa hat R. ein Zimmer in einem Konagi (Karagül Otel), einem traditionellen Haus mit großem Innenhof in einer sehr schmalen, alten Gasse. Sehr schön und angenehm. Die BMW wird auf einem abgeschlossenen Parkplatz in der gleichen Straße untergebracht. Das Konagi ist in Familienbesitz. Die Frau und der erwachsene Sohn meist mit ihren Handys beschäftigt und nicht mit dem Betrieb oder geschweige denn mit den Gästen. Der Vater des Mannes stammt aus Hamm.
Im großen Basar der Stadt schließen viele Stände bereits zwischen 18-19 Uhr. So sieht R. an diesem Abend nur einen Bruchteil davon. Mit einigen Handwerkern kommt er ins Gespräch und fotografiert sie (Ausdrucke als „Gegenleistung" sind wieder sehr willkommen). So kommen Bilder von einem Goldschmied, zwei Taubenzüchtern, einem jungen Mann, der Kupferteller in seinem Laden herstellt, zustande. Am Rande des Basars setzt er sich vor ein Lokal und isst – wie schon so oft – Köfte mit Gemüse. Hier gibt es sogar eine Tourismuspolizei, die nach dem Rechten schaut und auch sehr präsent ist. Zumindest auf dem Platz vor dem Basar.
Auf dem Weg in sein Hotel trifft R. in der Gasse noch auf einen Motorradfahrer aus der Schweiz, der auf dem Weg nach Georgien ist. Er hat einen Ersatzreifen auf seiner BMW K100 dabei, weil die unterwegs schwer zu bekommen sind.
Von der Stadt aus kann man die riesige Kreuzritterburg sehen, die jedoch wegen Renovierungsarbeiten (Erdbeben…) geschlossen ist. Bekannt ist die Stadt aber vor allem als Geburtsstätte Abrahams. Am Abend macht R. noch einen kurzen Abstecher zur Geburtsgrotte und beschließt, hier am nächstes morgen als erstes noch einmal vorbeizuschauen.












49. Tag; Dienstag, 21. Mai 2024; Şanliurfa
Şanliurfa, das wohl bereits seit rund 10.000 Jahren besiedelt ist, wird als Geburtsort Abrahams ausgegeben und sollte somit für alle drei abrahamitischen Religionen ein Pilgerort sein. Es ist die fünftheiligste Stätte des Islam. In der jüdisch-christlichen Legende wird der Geburtsort Abrahams jedoch im etwa 50km weit entfernten Harran verortet. Somit spielt Şanliurfa für Christen und Juden keine Rolle. Eigentlich. Denn einer unglaubwürdigen Legende nach, soll der damalige Herrscher mit Jesus Christus korrespondiert und von ihm ein Bild erhalten haben, dass den König Abgar V. heilte. Christen gab es hier schon sehr früh und ihre erste Kirche wurde nach Berichten bereits 201 durch ein Hochwasser zerstört. Die Stadt, die früher Edessa hieß, war lange ein Zentrum christlicher Gelehrsamkeit.
Ende des 19.- und Anfang des 20.-Jahrhunderts war die Stadt Schauplatz blutiger Progrome gegen Armenier und syrische Christen mit geschätzten 5-8.000 Toten. Im 21. Jhd, mit dem Erstarken des IS war Şanliurfa dann Drehpunkt für Dschihadisten, die nach Syrien wollten und im Gegenzug ca. 350.000 Menschen, die dem Krieg in Syrien zu entfliehen suchten.
R. Ziel am frühen Morgen ist Abrahams Geburtsgrotte und die dazu gehörende Moscheeanlage. Es ist noch ruhig. Fast niemand da. Eine gute Gelegenheit, ausgiebig mit dem iPhone auf einem Gimble zu filmen. Die Grotte ist mit einem bewachten Eingang versehen und sehr niedrig. Nur zwei Männer passen hier rein (Frauen haben einen separaten Eingang). Da bereits ein Gläubiger im Gebet versunken vor der Scheibe hockt, warten R. eine Weile, bis er allein ist und dann filmen kann. Durch ein Fenster sieht R. das Innere der Geburtsgrotte. Bedingt durch das Licht wachsen an einigen Stellen grüne Algen oder Moose. Als R. die Grotte verlässt, kommen weitere Gläubige zum Gebet. Er geht über das das riesige Gelände und wird aus einer Ecke des Gebäudes angerufen. Ein Mann signalisiert ihm, dorthin zu kommen. Er folgt etwas verwundert der Aufforderung. Wie sich herausstellt, ist der Mann der Koch der Suppenküche der Moschee. Gern nimmt R. das Angebot zum Frühstück (Suppe, Kräuter, Brot, Wasser). Zu ihm setzen sich zwei etwa 12-jährige Jungen, die, wie sich herausstellt, aus Syrien stammen und auf dem Weg zur Schule hier noch schnell frühstücken. R. bedankt sich beim Koch und spendet etwas Geld, bevor er weitergeht. Neben der Suppenküche sind die Werkstätten eines Kammmachers und eines Flötenbauers, der seinen Kunden gerade seine Produkte vorführt. Beim Kammmacher schaut R. zu, wie aus Ziegenhorn diverse Kämme entstehen. Bereitwillig lässt sich der Handwerker fotografieren und bittet R. in das Atelier, wo noch andere Maschinen stehen, die ihm der Kammmacher vorstellt.
Es finden sich mehr und mehr Gläubige in dem großen Komplex ein, der auch ein riesiges, rechteckig ummauertes Wasserbecken einschließt. Einer Legende nach wurde Abraham zu Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Er wusch sich vor der Vollstreckung des Urteils seine Sünden in diesem See ab und das Feuer konnte ihm nichts mehr anhaben. Die Karpfen sollen aus des Feuers Glut geboren sein. Daher füttern die Gläubigen die Fische und erhoffen sich dadurch Gutes.
Zurück im Hotel, nimmt R. ein spätes, zweites Frühstück im Innenhof des Konagi ein. Krämpfe in Waden und Fingern plagen ihn. Er nimmt von den Elektrolyten etwas ein, was eigentlich für den Fall von Durchfällen gedacht ist. Es hilft trotzdem.
Mittags will R. Geld (35€ Porto) an Miran in Mostar überweisen, damit der seine Wanderschuhe nach Deutschland schickt. Bei der Western Union wollen sie dafür von ihm 50€ Gebühren haben. R. lehnt dankend ab und beschließt, auf dem Rückweg wieder über Mostar zu fahren. Er klärt das dann mit Miran ab.
Der Nachmittag soll nach R. Vorstellung der riesigen Kreuzritterburg oberhalb der Stadt gelten. Leider ist diese aber durch das Erdbeben beschädigt und nicht zur Besichtigung freigegeben. Somit wendet er sich dem riesigen Basar der Stadt zu, der nach dem von Aleppo (gibt es den noch?) der zweitgrößte des Vorderen Orients sein soll. Der Basar ist ein Leckerbissen für den Fotografen: Handwerker und Händler aller Richtungen sind hier versammelt: Schreiner, Kupferschmiede, Schmuckschmiede, Schneider und so weiter. In den engen, teilweise überdachten Gassen des Basars fällt das Licht gelegentlich wie ein Scheinwerfer auf die Buden und Stände und taucht den Ort in ein geheimnisvolles Licht. Bevor es Abend wird, fotografiert R. noch einen jungen Mann an einem Imbissstand und gibt ihm einen Ausdruck des Fotos. Das hat eine Kettenreaktion zur Folge, die R. nicht abgesehen hat. Der Mann holt seine Freunde dazu und schließlich hat R. eine ganze Packung Druckerpapier benutzt, um den „Models“ zu danken. Dort isst er dann noch Dürüm Kebab, bevor er zum Hotel geht.
R. ist mit sich zufrieden.










50. Tag, Mittwoch, 22. Mai 2024; Fahrt nach Mardin; 250km.
Şanliurfa hat noch weitere religiöse Highlights zu bieten. R.s erster Halt auf der Fahrt nach Mardin befindet sich bereits am Stadtrand. Hier soll Gott Hiob (wird auch im Islam verehrt) auf unmenschliche Weise geprüft haben. Als Gott Hiobs Treue anerkannte, sagte er ihm, er solle ein Loch graben und das daraus sprudelnde Wasser trinken, damit er geheilt werde. Hat anscheinend funktioniert. Dieses Loch ist in Form eines Brunnens hier am Rande von Şanliurfa noch zu sehen (der Legende nach). Um den Brunnen herum wurde ein Moscheekomplex gebaut und Gläubige zapfen Wasser für ihre Flaschen und Kanister an den dafür installierten Wasserhähnen ab, da es Heilung bringen soll. R. probiert es. Dessen Geschmack scheint hier im Hintergrund zu stehen.
Der nächste Halt ist Harran, wo Abraham nach christlichem Verständnis geboren wurde und später von hier aus auf Gottes Befehl mit der ganzen Familie nach Kanaan ging. Der heute unwichtige Ort ist weit über 5.000 Jahren besiedelt und war bereits in der Anfangszeit des Christentums ein religiöses Zentrum. Später wurde hier die älteste islamische Universität (Medresa) gebaut. Bereits am Stadtrand wurde R. von einem freundlichen Herrn angesprochen, der ihm die Stadt zeigen wollte. Es sei Lehrer und nebenher Guide. Seine Familie lebt seit 350 Jahren hier in den typischen Trulli (Bienenkorbhäuser). R. besichtigt den Trulli-Komplex der Familie und trinkt einen ausgesprochen guten Kaffee mit Gewürzen. In dem aus neun miteinander verbundenen Einzel-Trulli bestehendem Komplex wohnte früher seine Familie mit Mann, drei Frauen, Kindern und Vieh. Danach zeigt er R. die alte Burg, die seit geraumer Zeit (nicht) saniert wird. Eine große Baustelle. Betreten (eigentlich) verboten. Der Guide will nun bezahlt werden, da R. weiterfahren möchte. 40€ luchst er ihm ab. Ein stattliches Gehalt. Einmal im Urlaub macht R. diesen Fehler…
Es geht weiter zu einem Brunnen, der etwa 60 Kilometer Richtung Mardin zu sehen sein soll. Mitten im Nichts zwischen ein paar verfallenen Häusern soll Moses an dem Brunnen seinen Durst gelöscht haben. Ansonsten ist der öde Ort einst ein wichtiges Zentrum für die Anbetung des Mondgottes Sin gewesen.
Er fährt weiter durch eine trostlose, anscheinend intensiv landwirtschaftlich genutzte, Gegend nahe der syrischen Grenze, die einst ein Brennpunkt der Völker und Religionen war.
Kurz vor und am Stadtrand der spektakulär an einem Berghang gelegenen Stadt Mardin wird R. zweimal von Kontrollposten der Polizei angehalten. Bei der zweiten Kontrolle spricht einer der Polizisten hervorragend Deutsch. Auf R.s Erstaunen erklärt ihm der Polizist, dass er es in der Schule gelernt hätte. Die Kollegen machen ein Foto des Polizisten, wie er neben R. Motorrad posiert und so tut, als würde er ihn kontrollieren. R. verabschiedet sich und fährt weiter in die Altstadt, wo sein AirB&B sein soll. Die steilen Gassen machen das Fahren und Auffinden des Hauses schwierig. Etwas verzweifelt hält R. an und geht in eine Bar. Einige junge Leute trinken dort Tee und Cola. Er versucht sie zu fragen, wo er die Adresse finden kann. Leider kann keiner helfen. So telefoniert R. mit der Wirtin, die selbst Fotografin ist, und erklärt, wo er ist. Mit einem Mal ruft eine Frau in gut 50m Entfernung auf einem Flachdach stehend, R.s Namen. Sie winkt zu R. hinüber. Es lässt das Motorrad dort stehen, wo es jetzt ist, da nur eine Treppe mit etwa 70 Stufen zu dem Haus führt. Er schleppt seine Sachen hinunter und richtet sich in seinem Zimmer ein.
Als er fertig ist, geht er noch ein wenig durch die Altstadt, die terrassenförmig angelegt ist, spazieren. Den Abend verbringt er mit der Wirtin und ihren Freunden auf der Terrasse des Hauses.










51. Tag; Donnerstag, 23. Mai 2024; Mardin
Die Unterkunft liegt gleich neben dem Basar. Auf dem Weg dorthin zum Frühstück begegnet R. der Müllabfuhr, bestehend aus einem Esel mit zwei großen Säcken rechts und links sowie dem Müllmann mit gelbem Plastikbesen und großer Müllschaufel. Ein anderer Müllesel trägt an den Seiten große Holzkästen, für den Abfall und die Utensilien des Müllmanns.
In einer kleinen Teestube bekommt R. eine Gemüsesuppe mit Fladenbrot, Zwiebeln und leicht scharfen Chili-Schoten. Er sitzt neben zwei anderen älteren Männern und jeder isst wortlos seine Suppe, die umgerechnet nicht einmal einen Euro kostet. Jeder isst seine Suppe anders: das Brot zerreißen und in der Suppe sich vollsaugen lassen; das Brot eintunken und davon abbeißen oder es einfach so essen. Vor der Teestube reitet ein junger Mann auf einem geschmückten, schwarzen Pferd vorbei Richtung Oberstadt zu einer großen Treppe vor dem Museum der Stadt, das sich in einem Palast befindet, vor dem Touristen für Geld Fotos von sich mit dem Pferd machen können. Der Stall für die Pferde befindet sich in einer Seitenstraße gegenüber der Teestube und R. sieht den Männern zu, wie sie sich um die edlen Tiere kümmern. Vor dem etwas tiefer als das Gassenniveau gelegenen Stall laufen Hühner mit ihren Küken herum und versuchen, etwas zu fressen zu finden. Ein Hahn passt auf.
In früheren Jahrhunderten war Mardin ein Zentrum christlicher Gelehrsamkeit. Heute findet man noch ein paar Kirchen im Stadtbild, die jedoch meist etwas versteckt und klein sind. R. besichtigt eine kleine protestantische Kirche. In einem alten Palast findet eine Ausstellung moderner Kunst statt. Über Treppen ohne Geländer geht er durch die Ausstellungsräume. Anscheinend wird die Ausstellung von Studentinnen organisiert, die auch Info-Material verteilen.
In einem anderen Museum trifft er vor allem auf Familien und Frauengruppen. Es scheint eine beliebte Freizeitgestaltung für türkische Frauen zu sein, in Gruppen auf Museumstour zu gehen. Das ist R. schon öfters aufgefallen. Die Frauen stellen sich schließlich für ein Foto auf und auch R. knipst fleißig die Damen auf ihrem Ausflug. Freundliches Gelächter erhält er dafür. Dieses Museum hat eine hohe, steinerne Kuppel mit einem schmalen Sims außen herum. Betreten verboten. Eine junge Frau in einem langen weißen Kleid interessiert das nicht. Sie geht darauf herum, um bessere Bilder mit ihrem Handy zu machen. Sie scheint keine Angst vor der Höhe zu haben oder der Wunsch nach einem besonderen Selfie ist größer. Es macht ihr kein anderer nach.
Da die Stadt an einem steilen Bergrücken gebaut wurde, kann R. von einer großen Dachterrasse aus über die mesopotamische Ebene nach Syrien hineinschauen. Irgendwo da unten ist die türkisch-syrische Grenze. Keine 40km entfernt.
Wieder zurück im Basar, breitet ein Bäcker seine Tabletts mit Baklava auf dem Gassenboden aus. Er will sie wohl nach und nach zu den Läden bringen. Wieder kommt ihm ein Mann auf einem Pferd entgegen. Es ist aber kein Prachthengst, sondern eher ein Maultier. Der Reiter sitzt dabei auf einem Packen von kleinen Teppichen und verschwindet hinter der nächsten Ecke.
Gegenüber der Teestube vom Morgen, in der R. jetzt einen Tee trinkt, sitzen Männer vor ihren Läden. Einer von ihnen hat zwei Haufen Tabak auf dem Tisch liegen, die er verkaufen will. Gelegentlich interessiert sich ein Kunde dafür und nimmt ein kleines Päckchen mit. Als es anfängt zu regnen, wird alles in den Laden geräumt und die Männer spielen unter einem Vordach Backgammon. Kunden bleiben jetzt aus. Auch der Mann mit dem schwarzen Prachthengst kommt zurück und versorgt sein schönes, etwas nervöses Pferd. Im Café unterhält sich R. mit einem anderen Fotografen, der aus der Türkei kommt. Man wartet auf das Ende des Regens, bevor es weiter geht. Zum Abschied fotografiert R. noch die Bedienung der Teestube und schenkt ihm das ausgedruckte Bild. Stolz befestigt er es an der Wand.
In der Unterkunft unterhält er sich noch mit einer asiatisch aussehenden Französin und einem Ehepaar aus Istanbul, das hier einen Workshop zu Klangschalentherapie gibt. Sie bieten R. an, auf dem Rückweg in Istanbul bei ihnen zu übernachten.
Den Abend lässt R. in der Bar oberhalb der Unterkunft „Hinar Home“ ausklingen. Dort trifft er auf einen der Freunde der Gastgeberin vom Vorabend.





















52. Tag, Freitag, 24. Mai; Fahrt nach Hakkari; 400km.
Am Stadtrand für den Tag Verpflegung in einer Bäckerei eingekauft: Simit. Der Blick zurück auf Mardin, wie es sich an den mächtigen Berghang schmiegt, ist beeindruckend. Erster Halt ist nicht weit von der Stadt entfernt ein orthodoxes Kloster (Ananias), das im 5. Jhd gegründet wurde und sehr gepflegt ist. Es ist der ehemalige Sitz des Patriarchen der syrisch-orthodoxen Kirche, die wegen der Besitzansprüche mit der türkischen Regierung im Clinch liegt. Bevor das Kloster gebaut wurde, war es eine Kultstätte für den Sonnengott Sin. Im Keller des Klosters besichtigt R. die Überreste dieser vorchristlichen Kultstätte.
Obwohl R. schon recht früh vor Ort ist, muss er wegen des großen Andrangs eine halbe Stunde bis zum Einlass des nächsten Pulks warten (Blockabfertigung…). Währenddessen unterhält er sich mit einem türkischen BMW-Fahrer aus Ankara, der das gleiche Motorrad fährt wie er. Nach der Besichtigung der imposanten Anlage fährt R. weiter nach Midyat, das bis Ende der 70er Jahre das größte (assyrisch) christliche Gebiet (nach Istanbul) war. Sie gerieten allerdings zwischen die Fronten der türkischen Regierung auf der einen Seite und den Kurden auf der anderen Seite. Bis Ende der 90er Jahre verließen die meisten Christen das Gebiet fluchtartig. R. isst hier zu Mittag und fährt dann weiter zum sehenswerten Kloster Mar Gabriel.
Eigentlich will R. in Şirnak übernachten, fährt aber weiter bis nach Hakkari. Die Straße führt teilweise direkt an der irakischen Grenze entlang. R. wird sich dessen erst gar nicht bewusst. Alles ruhig dort. Nur ein Bach trennt ihn vom Irak. Danach über regennasse Bergstraßen durch das wilde Kurdistan. Hier war einst die Hochburg des kurdischen Widerstands. Hakkari. Eigentlich schön auf einem Bergrücken gelegen, hat die Stadt nichts Sehenswertes. Viele hässliche Neubauten. Auf den Bergen ringsherum liegt noch Schnee. Es ist kalt. Erst spät erreicht R. sein Hotel in der Innenstadt. Er ist erschöpft und die Knochen schmerzen von der langen Fahrt. Der Kreisverkehr mit einer modernen Glas- und Stahlskulptur vor dem Hotel wird von einem gepanzerten Militärfahrzeug gesichert.
53. Tag, Samstag, 25. Mai 2024; Fahrt nach Van; 200km
Interessantes Frühstück. R. wird von einem Mann aus Schleswig-Holstein angesprochen, der hier Entwicklungsprojekte umsetzt. Seit Jahren ist er sowohl in der Türkei als auch in anderen Ländern unterwegs, um die Müllentsorgung zu verbessern. Und obwohl er schon 70 Jahre alt ist, macht er aus Spaß an der Arbeit weiter. Da die Menschen (und Gemeinden) hier nicht das Geld für die Müllentsorgung haben, übernimmt die EU 80% der Projektkosten. Bedauerlicherweise werden die Anlagen nach Fertigstellung meist nicht gepflegt und verkommen. Daher besucht er einmal fertige Anlagen nie wieder. Sie sprechen auch über die Bagdad-Bahn und den deutschen Einfluss im Osmanischen Reich. Schon damals – so der ältere Herr - wurde gesagt, dass die Zusammenarbeit immer dann gut ist, wenn Armenier beteiligt sind.
Kurz nach der Abfahrt hält R. Stadtrand noch einmal an und geht zu einem Aussichtspunkt, von wo aus er die Stadt und das überblicken kann. Eine Firma scheint hierher einen Ausflug zu machen. So kommt er mit ein paar Männern ins Gespräch und fotografiert sie. Sie fragen R., wie ihm die Türkei gefällt und insbesondere Kurdistan…
Die Fahrt führt R. durch eine landschaftlich reizvolle Gegend. An einem Fluss sieht er im Talg eine Hängebrücke, über die ein Hirte seine Herde führt. Obwohl R. weit oberhalb der Herde am Straßenrand steht, wird der große Schäferhund auf ihn aufmerksam und bellt. Lieber nicht näher herangehen, denkt sich R..
In der Stadt Van, am gleichnamigen See gelegen, bezieht R. ein einfaches Hotel an der Hauptstraße. Er nutzt den Nachmittag für einen Spaziergang durch die etwas öde Stadt. In einem Café lässt ihm die Bedienung einen Zettel zukommen, auf dem steht, dass sich jemand gerne mit ihm auf Englisch unterhalten wolle. Es sind die zwei jungen Frauen vom Nachbartisch. R. gesellt sich zu ihnen. Eine von ihnen spricht Englisch. Sie möchte mit R. das Sprechen etwas über, da sie ein Diplom in Englisch hat. Ihr Traum ist es, in Europa zu arbeiten, vor allem in Deutschland oder den Niederlanden. Sie möchte wissen, wie sie das machen und auch eine Arbeitsgenehmigung bekommen könne. R. kann ihr das leider nicht sagen und empfiehlt ihr, sich zum Beispiel mit dem Goetheinstitut in Istanbul oder Ankara in Verbindung zu setzen, um zu erfahren, wie man Diplome anerkennen lassen kann. Dort könne sie auch Deutsch lernen. R. überlegt noch, ob er ihr sagen soll, dass ihr Englisch für eine gehobene Position noch nicht ausreicht; lässt es dann lieber. Dann leitet die Frau das Gespräch in eine ganz andere Richtung. Sie ist Ende 30 und möchte heiraten und Kinder bekommen. Findet keinen Mann, der ihr gefällt. Zudem beginnt ihre Menopause verfrüht. Sie möchte sich andere Ovarien transplantieren lassen. R. versucht, sich langsam aus dem Gespräch zurückzuziehen. Schließlich empfiehlt er ihr, sich bei Fachärzten in Istanbul zu erkundigen und findet einen Vorwand, das Lokal zu verlassen.
In einer der Seitenstraßen begegnen ihm Gemüseverkäufer mit einem komischen, länglichen, grünen Gemüse, das ein wenig wie Rhabarber aussieht. Die Leute ziehen allerdings die äußere Schicht des Stängels ab und essen den inneren, nur bleistiftdicken Teil. Der Verkäufer wird auf R. Interesse aufmerksam und gibt ihm ein Stück zum Probieren. Es schmeckt säuerlich und erfrischend. Natürlich macht er noch Fotos der Verkäufer, die sich auf dem dreirädrigen Minilastwagen à la Piaggo in Pose setzen.
Zufällig findet R. eine große Markthalle, in der er mit ein paar Käse-Verkäufern ins Gespräch kommt, sie fotografiert und ihnen Ausdrucke gibt. Daraufhin holt einer der Verkäufer gleich einen befreundeten Händler aus einem anderen Laden, damit er sich auch fotografieren lässt.
Er streift noch ein wenig durch die Stadt und findet zufällig ein Geschäft, das auch Bier verkauft. Eine Rarität. Er nimmt eins mit und trinkt es im Hotel.





54. Tag; Sonntag, 26. Mai 2024; Fahrt nach Tatvan; 150km
Es ist regnerisch. Es ist kalt. Sein erstes Ziel ist das von Krieg (1915) und Erdbeben zerstörte armenische Kloster aus dem 11. Jhd im Bergdorf Bakraçli. Das Dorf ist im Verfall begriffen. Die Gehöfte sehen aus, wie vor 200 Jahren. Verfallende Häuser aus verwitterten Lehmziegeln, getrockneter Dung zum Heizen, schlechte, unbefestigte Wege. Von dem armenischen Kloster sind nur noch ein paar Ruinen erhalten, unter anderem das Tor mit den armenischen Inschriften. Über dem Eingang ein provisorisches Dach aus Wellblech. Davor ein Bretterzaun. Kein Hineinkommen möglich. Der Weg führt R. um die Kirchenruine herum, vorbei an Häusern mit zerborstenen Fensterscheiben, die mit weißer Plastikfolie notdürftig abgedeckt sind.
Als R. weitergeht, wird ihm aus einer alten, steinernen Scheune zugerufen. Es geht hin und sieht einige Männer und Jungen beim Frühstück im Dunkeln sitzen. Er soll sich zu ihnen gesellen. Er setzt sich dazu. Ihm wird zu Essen und zu Trinken gegeben. Es gibt frisches Fladenbrot, Rührei, Suçuk, salzigen Käse, Gemüse, Kuchen und Tee. Die Hühner versuchen immer wieder, ihren Anteil an der Mahlzeit zu bekommen und werden von den Männern verscheucht. Nach dem Frühstück gehen sie nach hinten in die düstere Scheune und arbeiten am Fußboden weiter. Nachdem R. ein paar Fotos gemacht, diese ausgedruckt und zusätzlich über WhatsApp geteilt hat, geht er weiter durch das armselige Bergdorf, bevor er weiterfährt. Richtung Tatvan. Unterwegs hält er bei Gevaş gegenüber der kleinen Insel mit seiner touristischen Kirche zum Mittagessen an. Im lokal auf der anderen Straßenseite steht eine große Gruppe von Motorrädern mit deutschen Kennzeichen. R. fährt nicht mit dem kleinen Ausflugsboot rüber zur Insel, sondern weiter zum Tagesziel.
In Tatvan angekommen, sucht er sich ein Hotel an der Hauptstraße und geht anschließend auf der sehr in Mitleidenschaft gezogenen Seepromenade entlang. In flachem Wasser stehen lange Stangen, die mit Schnüren, an denen Luftballon hängen, verbunden sind. Auf der Promenade haben Männer kleine Stände mit Luftgewehren aufgebaut. Schießstände also.
Eine junge Frau beobachtet ihn, wie er fotografiert und sagt ihm auf Englisch, dass sie gerne fotografiert werden möchte. Sie zögert jedoch, als sich eine Gruppe Jugendlicher nähert und gibt ihm zu verstehen, dass er warten soll. Als die Jungen weg sind, ist sie für ein Foto bereit. Sie bekommt das Foto per WhatsApp zugeschickt.
Abends ist in der Stadt die Hölle los: Galatasaray spielt gegen Fenerbahçe. Galata gewinnt und wir Ligameister. Die ganze Nacht wird gefeiert. R. fragt den Hotelier, ob hier alle Galata Fans sind? Nein, meint er, etwa fifty-fifty. Egal, wer gewinnt, es wird auf jeden Fall gefeiert.
Im Hotel sind noch zwei türkische Biker angekommen; einer mit seiner Ehefrau. Sie kommen gerade aus Georgien. Es sei sehr windig dort. Sie erklären R. auch, wo er an der Grenze die Haftpflichtversicherung erhält.









55. Tag; Montag, 27. Mai 2024; Fahrt nach Doğubayazit; 300km.
Morgens, bei gutem Wetter, fährt R. zum Krater Nemrut Daği, der nur ein paar Kilometer entfernt ist. Seine Überlegung gestern war noch, hier oben zu Zelten. Aber dafür ist es viel zu kalt. Es liegt noch meterhoch Schnee am Kraterrand neben der Kopfsteinpflasterstraße. Unten im Krater stehen nur ein paar Wohnmobile. Durch einen kleinen, sehr farbenfrohen Wald führt ihn die schmale, teilweise stark erodierte Straße zum großen Kratersee, an dessen Ufer eine Teebude steht. Er ist der erste Kunde in dieser aus Latten und Pfoste selbstgebauten, windigen Hütte. Davor stehen Plastikstühle. R. bestellt einen Tee. Der Wirt kann den kleinen Geldschein (umgerechnet 10€) nicht wechseln. So macht R. ein Foto, druckt es aus und schenkt es dem Teebudenwirt, der es gleich an die Holzwand heftet.
Für den Weg aus dem Krater heraus nimmt R. eine unbefestigte Straße, mit viel Sand, Geröll und enormen Auswaschungen. Das fordert all seine Fahrkünste. Es geht alles gut. Die aufregende Landschaft entschädigt ihn dafür.
In Doğubayazit angekommen, fährt er zum Hostel, das vor allem von Wohnmobilisten mit Geländefahrzeugen genutzt wird. Es ist für sie die letzte Station vor Iran. R. unterhält sich mit den Leuten aus Deutschland und den Niederlanden. Keiner versteht, warum R. davon absieht, in den Iran zu fahren.
Am Abend fotografieren sie gemeinsam den Ararat im schwächer werdenden Licht.







56. Tag; Dienstag, 28. Mai 2024; Doğubayazit; Berg Ararat; 50km.
Morgens bis 9h30 viel Regen. R. wartet , bis es aufhört und fährt dann in Richtung Berg Ararat, auf dem Noah mit seiner Arche gelandet sein soll. Die Suche danach geht weiter.
Die Straße, die er nehmen will, ist durch Militär versperrt. Nur für Anwohner frei. Also einen anderen Weg nehmen. Er begegnet den beiden Holländerinnen, die in der Nähe mit ihrem VW-Bus stehen und überlegen, ob sie zur nahen irenischen Grenze fahren sollen. Nachdem R. ihnen einen schönen Tag gewünscht hat, fährt er weiter und findet einen Feldweg, der in Richtung Ararat geht. Dieser führt langsam bergan und endet nach ein paar Kilometern in der kleinen Bauernschaft Cevirme am Hang des Berges. Der Bauer möchte nicht fotografiert werden, aber das Gehöft darf er ablichten. Auf dem Rückweg kommt er an einer kleinen Herde freilaufender Pferde vorbei.
Am Nachmittag geht es in die Stadt auf den Markt. Unter einer Zeltplane sitzen drei Männer und schauen sich etwas auf Tic Toc an. Einer von ihnen winkt R. zu. Er soll sich dazu setzen. Sie unterhalten sich ein wenig über Google-Translator, bevor sich ein weiterer älterer Herr dazusetzt. Er spricht etwas Englisch und fragt ihn, was er hier macht. R. erzählt von seiner Reise. Der Mann ist Lehrer an einer Dorfschule in der Nähe und lädt R. ein, am nächsten Tag vorbeizukommen, um mit den Kindern Englisch zu reden. Er nimmt das Angebot dankend an. Nach ein paar Fotos, die er ihnen als Ausdrucke gibt, schickt einer der Männer einen Jungen los, um Datteln für R. zu holen. Anscheinend ist er Obsthändler. R. bedankt sich bei ihm herzlich und sie gehen auseinander.
Wieder in der Unterkunft, sind zwei weitere Gelände-Womos angekommen. Schweizer und Südtiroler, die sich kennen. Sie waren gefühlt schon überall mit ihren Gefährten. Arabien, Marokko, Iran, etc...








Tag 57; Mittwoch, 29. Mai 2024; Fahrt nach Kars; 200km.
Heute Vormittag fährt R. auf Einladung des Lehrers Mehmet Tabar in seine Schule in Bereket bei Doğubayazit. Es ist nicht einfach, diesen kleinen Ort zu finden. Zuerst sucht er in einem Dorf mit steilen Schotterstraßen am Hang des Ararat danach. Erfolglos. Das Navi ist nur bedingt eine Hilfe dabei. Schließlich ruft R. Tabar an, der ihm den Weg erklärt. Zwei Kurven später erreicht er die Schule. Etwa 120 Schüler bis Klasse acht gehen hier zur Schule. Herr Tabar gibt R. als Englischlehrer aus und bringt ihn zuerst zur Rektorin. Bei einem angenehmen Gespräch gibt es Tee und Kekse. Anschließend geht es durch die Klassen 3-8. Überall stellt R. sich vor. Die Schüler stellen Fragen. Meist die gleichen. Wer sind Sie? Woher kommen Sie? Wohin fahren Sie? Und so weiter. Es ist eine Mischung von Englisch mit Türkisch. Herr Tabar und die Lehrerinnen helfen aus. In einer Klasse mussten Herr Tabar und R. ein englisches Lied singen. Ihnen fiel nur „What shall we do with a drunken sailor?“ ein. Ein Spaß für alle. Nach dem Rundgang ist Mittagspause. In der Schulmensa gibt es für alle ein warmes Essen. R. geht mit und einige Jungs setzen sich direkt zu ihm. Es wird eng, da viele bei ihm sitzen wollen. Die Mädchen vom Nachbartisch schielen kichernd herüber. Nach dem Essen spielen die Kinder auf dem Hof mit Bällen. Eine Lehrerin lässt auf dem Pausenhof Musik ertönen und alle fangen an, im Reigen zu tanzen. R. macht mit. Bevor die Pause zu Ende geht, werden noch Erinnerungsfotos gemacht. Der Abschied fällt schwer und R. wird gefragt, wann er wiederkommt. Vielleicht nächstes Jahr, sagt er. Wenn er vielleicht nach Iran fährt…
Über eine weite Steppenlandschaft geht es erst nach Ani, der in Ruinen liegenden, ehemaligen armenischen Hauptstadt vor 1.000 Jahren. Sie liegt in Sichtweite der armenischen Grenze.
In dem günstigen Hotel im wenig attraktiven Kars trifft R. auf einige Touristen aus Spanien und Tschechien. Nach dem Einchecken geht er durch die Stadt und sucht einen Frisör. Davon gibt es genügend. Er sucht sich einen „Kuaför“ aus und lässt sich Haare und Bart schneiden, indem er ihm ein Bild zeigt, dass er von seiner Frau einmal als Beispiel bekommen hat. Der Kuaför bittet R. um etwas Geduld, da er jetzt erst sein Abendgebet verrichten möchte. Danach legt der Frisör los. Er stellt fest, dass man in der Türkei die Haare nach dem Schneiden wäscht und nicht vorher, wie in Deutschland. So hat er keine kleinen, pieksigen Haare in der Kleidung. Er fragt R., warum er denn alleine, ohne seine Frau, unterwegs sei. R. erwiderte, dass seine Frau noch arbeiten müssen. Der Kuaför fing laut an zu lachen.



58. Tag; Donnerstag, 30. Mai; Fahrt nach Gyumri, Armenien; 200km
R. wacht viel zu früh auf und beschließt, eine Fototour durch die noch schlafende Stadt zu machen. Es gibt viele Seitenstraßen mit schäbigen Läden. In den Straßen liegen lange Moniereisen, die auf ihre Aufgabe warten. Eine alte Couchgarnitur ist ohne Nutzen. Das Sofa steht auf einen kleinen Schrank in der Höhe. Manche ehemalige Ladetüren sind mit Brettern verschlossen. Wenige Läden bereiten sich auf den Tag vor und stellen ihre Waren vor das Geschäft. Meist Baumaterialien. Teestuben haben noch nicht geöffnet. Ein paar alte Männer gehen durch die ansonsten noch leeren Straßen.
Nach dem Frühstück fährt R. erst einmal an einem See vorbei bis Çildir. R. ist durchgefroren und geht in eine winzige Teestube, in der einige Männer sind. Sie sitzen auf kleinen Sofas oder auf der Fensterbank. Der Wirt spendiert ihm einen Tee und schenkt ihm 15TL. Sie R. so bedürftig aus? Er ist verwirrt, was er tun soll.
Da die Grenzübergänge zu Armenien weiterhin gesperrt sind, muss R. bis an die georgische Grenze vorbei am Karsachi-See. Der Grenzübergang ist recht klein. Alles geht schnell. An der Grenze holt R. sich eine Haftpflichtversicherung und will weiterfahren, nach Akhalkalaki in Georgien. Leider wird die Straße gerade neu gemacht und ein riesiges Arbeitsgerät hat den Boden tiefgründig aufgelockert. Er besteht aus pulverigem Sand durchsetzt mit Kindskopf-großen Flusskiesel. Schon nach gut 50 Metern im von entgegenkommenden LKW aufgewirbeltem Staub verliert R. die Kontrolle über das Vorderrad und stürzt in den weichen Sand. Der Maschinenführer sieht keine Notwendigkeit, R. zu helfen, das Motorrad wieder aufzurichten. Er ist nach mehrmaligen Bitten steigt der Mann hinab, um zu helfen. Selbst zu zweit tun sie sich schwer, die BMW wieder aufzurichten. Der Mann empfiehlt R., langsamer zu fahren. Das tut R. dann auch auf der noch seiner noch unbefahrenen Seite der Straße, bleibt aber einige hundert Meter später mit dem Hinterrad an einem großen Stein hängen, der im losen Sand nicht zu sehen war. Der Autofahrer hinter ihm springt sogleich aus seinem Auto und schiebt R. an, damit er wieder freikommt. R. bedankt sich tausendmal.
In Akhalkalaki angekommen, holt R. Geld aus einem Automaten und kauft sich im Supermarkt etwas zu Essen, was er an einer Bushaltestelle verspeist.
Die Straßen in Georgien sind für Motorradfahrer der absolute Graus! Riesige Schlaglöcher säumen den Weg nach Armenien. Manche sind so groß, dass man dort Autoreifen reingestellt und zur besseren Sichtbarkeit zusätzlich einen Stock mit Trassierband daran befestigt hat.
An der armenischen Grenze angekommen, heißt es warten. Die Prozedur dauert zwei Stunden. Die Beamtin nimmt R.s Daten mindestens zehnmal in irgendwelchen Systemen auf. Dann Versicherung (25€) kaufen und wieder zur Zollbeamtin zurück. Umgerechnet 15€ Einfuhrgebühr für das Motorrad zahlen und wieder Daten in irgendwelche Systeme eingeben. Hinter mir waren ein paar Inder mit einem Mietwagen aus Tbilissi da und haben den Übergang nicht geschafft, da die Leihwagenpapiere nicht auf ihren Namen ausgestellt waren. Hier wird alles sehr genau genommen. Irgendwann hat R. es geschafft und fährt nach Gyumri, der zweitgrößten armenischen Stadt. R. schlendert durch die heruntergekommene Stadt und „bewundert“ den Baustil und vor allem die Fahrzeuge. Willkommen in Sowjetistan! Als würde das Land immer noch zur Sowjetunion gehören, hat hier alles noch den Charme des längst Vergangenen.
Während des Abendessens beobachtet R., wie der Fahrer eines historischen, blau-weiß gestrichenen LKW einen riesigen Anhänger, beladen mit Moniereisen, rückwärts in einen Innenhof fährt. Es sind etliche Fahrmanöver notwendig, um das zu vollbringen. Der Fahrer, ein älterer Mann, sitzt in der zu eng erscheinenden Kabine, mit einer Zigarette im Mundwinkel und befolgt die lautstarken Anweisungen der Einweiser. Diese Szene hätte irgendwann in den letzten 50 Jahren spielen können, ohne dass jemand gemerkt hätte, dass wir das Jahr 2024 schreiben. Viele der PKW und LKW fahren mit Gas (aus der Sowjetunion, Verzeihung, Russland?).
Eine Nacht reicht für diese Stadt.







59. Tag; Freitag, 31. Mai 2024; Fahrt nach Yeghegnadzor; 310km.
Eigentlich hat R. geplant, als erstes in Harichavank Kloster anzuhalten. Die Straßen dorthin sind in einem jämmerlichen Zustand, Der Belag liegt teilweise in großen Platten verstreut auf der Fahrbahn und R. wechselt häufig die Seite, um ihnen oder den daraus resultierenden Löchern, auszuweichen. Nach einiger Zeit hat er das Gefühl, sie verfahren zu haben. Er fragt zwei Frauen in einem Ort, die ihm seinen Verdacht bestätigen. Um wieder auf den rechten Weg zu gelangen, müsste er einen sich auf einen Berg windenden, sandigen Pfad durch endlose Weiden nehmen. Er beschließt umzudrehen und das Zeil vor seiner Liste zu streichen. Weiter geht es zur Ruine der Basilika Yereruyk, ein UNESCO Weltkulturerbe. Sie wird gerade restauriert. Kurz nach seiner Ankunft kommt eine Militärpatrouille vom nahen Grenzposten, die ihn fragt, was er da mache. Er antwortet, dass er Tourist ist und das Gotteshaus besichtigt. Sie haben seine Papiere kontrolliert und ihn darauf hingewiesen, dass er keine Fotos der Umgebung machen darf, da nur wenige hundert Meter weiter die türkische Grenze ist. R. sagt OK, wundert sich jedoch über die Vorsichtsmaßnahmen, da zwischen den Ländern eine mindestens einhundert Meter tiefe Schlucht liegt, deren Flanken so steil sind, dass man nicht einmal zu Fuß runter oder hoch kommt. An der nächsten Kreuzung steht noch ein großes Denkmal mit Hammer und Sichel drauf. Sowjetistan. Neben der Straße hat ein Kuhhirte ein Gehege für seine Rinder mit Autowracks als Zaun gebaut.
In einem kleinen Dorf befindet an der Hauptstraße ein kleiner Friedhof mit lebensgroßen Abbildern der Toten. Diese Stelen stehen am hinteren Ende der Grabkammer und zeigen Soldaten. R. macht Fotos und ein anderer Besucher bedankt sich bei ihm für sein Interesse. R. findet nicht heraus, in welchem Konflikt sie gefallen sind. Es scheint sich aber um einen armenisch-türkischen Konflikt zu handeln, da bei einem der Stelen der Ararat im Hintergrund erkennbar ist. Da die Schrift armenische ist, kann R. sich nicht lesen. Neben diesem Friedhof steht an einer Garage ein alter weiß-blauer Bus und verrottet langsam vor sich hin. Er steht direkt vor einer mehrere Meter großen Reklame für einen Mercedes G. Krasser kann der unterschied nicht sein.
Etwa eine halbe Stunde später, in Aknalich bei Yerevan, kommt R. am größten yezidischen Tempel der Welt an. Er ist neu, schneeweiß und in einer Art Parkanlage gelegen. Riesige Statuen mit Engeln und Menschendarstellungen säumen den Weg zum Tempel. Das Gebäude wird vor einer mächtigen, kegelförmigen Kuppel getragen. Um die zentrale Kuppel (Erzengel Gabriel gewidmet) herum sind sieben kleinere Kuppel (entsprechend den sieben Erzengeln, die die Welt erschaffen haben) angebracht. Über dem Eingangsportal befindet sich eine Große Marmorscheibe mit einem Muster aus Blütenblättern und einer angedeuteten Kugel in der Mitte. Das Innere besteht nur aus einem Raum mit sieben Wandnischen. In der dem Eingang gegenüberliegenden Nische ist ein blauer Pfau dargestellt. Nach jesidischer Mythologie hat Gott aus seinem Licht in der Form eines siebenfarbigen Regenbogens den Engel Melek Taus geschaffen. Dieser „Pfauen-Engel“ ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Glaube ist monotheistisch. Gleich neben der Tempelanlage befindet sich der yezidische Friedhof, wiederum mit lebensgroßen Abbildern der Verstorben. R. würde hier nachts nicht entlang gehen…
R.s nächster Halt ist die riesige orthodoxe Tempelanlage in Ejmiatsin. Es ist der Hauptsitz der armenisch-orthodoxen Kirche und besteht seit Anfang des vierten Jahrhunderts, erbaut auf einer noch älteren heidnischen Tempelanlage. R. verweilt nicht lange, sondern macht sich aufgrund der bedrohlichen Regenwolken auf den weiteren Weg nach Yeghegnadzor.
Als R. nach seiner Ankunft in die Stadt zum Essen gehen will, wird er von einem heftigen Gewitter mit sintflutartigen Regengüssen überrascht und warten dessen Ende in einem kleinen Laden ab. Dort kauft er sich dann etwas zu essen. In der Unterkunft hat R. eine komplette Wohnung in dem großen, an einem Hang gelegenen Wohnhaus für sich. Die Familie wohnt im Souterrain mit Ausgang zum Garten. Die Gegend ist für Obst und Weinanbau bekannt. Überall kann man Früchte in jeglicher Form kaufen. Auch Schnaps. Abend fällt der Strom wegen des andauernden Gewitters aus und R. nutzt seine Campinglampe. Da der Herd mit Gas betrieben wird, kann er trotzdem seinen Einkauf verarbeiten.









60. Tag; Samstag, 1. Juni 2024; Yeghegnadzor; 150km
Nach dem Frühstück geht es auf Erkundung durch die bergige Umgebung. Als erstes zum Kloster von Noravank. Auf dem Weg dorthin hält R. an einem Gasthaus an, an dem Brot auf traditionelle Weise in einem Erdofen gebacken wird. Das Kloster ist eines der bekanntesten Armeniens und ist bei Touristen sehr beliebt. Es sind unter anderem drei slowenische GS-Fahrer dort, die einen zwei-wöchigen Trip hierher inklusive Georgien machen. Sie sitzen wahrscheinlich mehr im Sattel als anderswo. Das wäre nichts für R.. Die Kirche ist sehr dunkel, jedoch fällt durch eine Öffnung in der Kuppel ein Lichtstrahl und die Kinder spielen damit, indem sie sich in das Licht stellen. Man hat den Eindruck, sie würden gleich in den Himmel gesogen.
Der nächste Halt ist die alte Orbelian Karawanserei an der Passtraße. Sie ist zwar sehr gut erhalten, aber stockduster und sehr feucht. Auf dem Rückweg die Passstraße hinunter, begegnet R. einem französischen Radfahrer aus Nantes. Er schiebt sein Rad bereits seit 10km und hat noch 5km vor sich. R. kann sich nicht vorstellen, dass das Spaß macht. Weiter nach Shatin und in die Seitentäler. Er sucht, einen alten jüdischen Friedhof in Yegeges, findet ihn aber nicht. Er fragt zwei Jungen danach. Die wollen für die Auskunft Geld haben. R. fährt weiter. Weiter das schöne Tal entlang. Am Ende eines weiteren Seitentals dreht R. um, da der Weg zu schlecht wird. Auf dem Rückweg begegnet ihm ein Ehepaar aus Starnberg, das mit seinem Gelände-Womo von einer Passstraße kommt, die R. eigentlich nehmen will. Sie haben jedoch kehrt gemacht, da es zu viel Erosion gibt. R. entscheidet sich, die bessere Straße, die er gekommen ist, auch wieder zurückzufahren. In Shatin lässt R. sein Motorrad an einer kleinen Waschanlage sauber machen. Er ist Zeit dafür. Alles dreckig und voller Staub. Die Scheinwerfen leuchten fast nicht mehr die Straße aus.
Ein anderes Kloster (Tanahati Vank) kann R. auch nicht erreichen, da der Schotterweg mit tiefen Wasserlöchern übersäht ist. Ein Mercedes Sprinter kommt zwar aus der gewünschten Richtung, jedoch hat der vier Räder…
61. Tag; Sonntag, 2. Juni; Fahrt nach Goris; 170km
Das Frühstück ist sehr gut! Als R. das Hotel bezahlen möchte, funktioniert das Lesegerät nicht. Barzahlung. Meist versucht R., mit der Karte zu zahlen, damit er nicht so häufig für immense Gebühren Bargeld abheben muss. Gut, jede Kartenzahlung kostet auch etwas. Ist aber weniger als die Gebühr am Automaten. Bei der Abfahrt noch gemerkt, dass der Rucksack mit den Regensachen fehlt. Also geht er wieder ins Hotel und holt den Rucksack. So etwas darf nicht passieren. Zurückfahren wäre eine schlechte Alternative.
Das erste Highlight ist der Vorotan Pass mit seinen mächtigen in den Himmel ragenden Bauwerken rechts und links der Straße. Was sie bedeuten sollen, kann R. nicht herausfinden. An den Seiten sind Weintrauben-Dekorationen und Landarbeiter mit Ochsen und Pflug in den Sandstein gehauen. Alle halten hier an und manche kaufen etwas an den wenigen Ständen in dieser windigen Gegend. Er kommt mit ein paar Leuten ins Gespräch und es stellt sich heraus, dass sie Iraner sind und Urlaub machen. Der Sohn der Familie darf sich auf R. Motorrad setzen und es wird natürlich das obligatorische Foto mit Ausdruck gemacht. Im Gegenzug schenkt der Vater ihm ein kleines Taschenmesser.
Wenig später muss R. anhalten, um eine große Schaf- und Ziegenherde samt „Cowboys“ vorbeizulassen. Die Fahrt geht weiter nach Aghitu Denkmal. Man weiß nicht so genau, wofür dieses steinerne Denkmal mit übereinander angeordneten Bögen gemacht wurde. Um dieses Denkmal herum liegen Grabsteine und Kreuzsteine. Kreuzsteine sind ein typisch armenisches Kultsymbol. Man begegnet ihnen überall. Sie wurden als Gedenken an jemanden oder an ein Ereignis gemacht.
In Sisian macht R. Mittagspause und holt sich einen Döner, den er einem Taxistand isst. Als die Taxifahrer sehen, dass er aus Deutschland kommt, fällt ihnen nicht besseres ein, als einen H…-Gruß zu machen. R. zeigt ihnen den Daumen nach unten und fährt weiter. Anscheinend hat sich hier noch nicht herumgesprochen, dass die Zeiten sich geändert haben. Es ist jedoch auch nicht das erste Mal, dass ihm das passiert. Die Menschen, die das machen, haben häufig keinen Bezug zu dazu.
Heute gibt es eine Sehenswürdigkeit nach der anderen. Manche lässt R. aus, da die oft unbefestigten Wege in einem sehr schlechten Zustand sind. Leicht erreichbar ist das berühmte Kloster Vorotnavank. Es ist mindestens 1.000 Jahre alt.
Erfreut ist R. über eine neu ausgebaute Straße, die vom Kloster über Ltsen nach Tatev führt. Am Kloster Tatev trinkt R. etwas, bevor er die sehr steile Serpentinenstraße hinab und anschließend auf der anderen Seite wieder hinauffährt. Diese paar Kilometer haben es in sich und bieten eine atemberaubende Sicht auf das Tal! Es geht noch etwas weiter bis Goris, wo R. übernachtet. Der Ort wird gerade saniert und bekommt neue Straßen und Bürgersteige. Beides gepflastert und sehr ansprechend. Auch die Gebäude in den Hauptstraßen wirken restauriert. An anderer Stelle ist alles noch in einem sehr schlechten Zustand und wartet auf baldige Verschönerung.














62. Tag; Montag, 3. Juni 2024; Goris Umgebung und Tatev; 150km.
Nach dem Frühstück geht es erst kurz nach Khudzoresk, einem alten Höhlendorf, das Mitte der 60er Jahre in einen neu gebauten Ort umgesiedelt wurde. Das gab es anscheinend häufiger, wie R. feststellte. Es gab in dem alten Ort etwa 5.000 Höhlen, von denen ca. 1.800 bewohnt waren. Zwei Kirchen, die alte in einer Höhle. Transportmittel war bis in die 50er Jahre das Kamel. Nach dem Umzug bauten die Bewohner eine Hängebrücke über die tiefe Schlucht zu den neuen Behausungen. Der Weg vom neuen Ort zu dieser Hängebrücke ist miserabel! Sand, Schotter, Erosionsrinnen. An der Brücke angekommen, sitzen zwei ältere Männer an einem Tisch und trinken Kaffee. Die großen Zelte mit Einrichtungen für Besucher sind noch leer. R. ist der erste heute. Einer der Männer geht mit R. die Stufen zum Museum runter. Es ist sein Museum. Dr Mann lädt ihn gegen eine geringe Gebühr zum Besuch seiner ehemaligen Behausung ein. Der „Guide“ möchte R. auch durch das Dorf auf der gegenüberliegenden Seite der Schlucht führen. R. lehnt dankend ab. Trotzdem dauert es etwas, bis der Mann das akzeptiert. Er macht von R. noch ein paar Fotos auf der Brücke, bevor beide sich voneinander verabschieden. Höhlendörfer gibt überall auf der Welt ein wenig, z.B. im Loiretal bei Saumur oder in Kappadokien. Dieses Dorf ist nach den Jahrzehnten der Einsamkeit wieder von der Natur in Besitz genommen wurden. Aus dem Meer an Bäumen schaut nur noch die Kirche heraus. Alles andere ist überwuchert. Inmitten des Dorfen, unweit dieser Kirche, hat irgendjemand sein Lager aufgeschlagen. Hängematte, Kochgelegenheit, ein paar Alltagsgegenstände. Ein Mann mit ein paar Maultieren kommt in das Dorf. Wohl als Fortbewegungsmittel für Touristen. Er stellt die Tiere in einer der verlassenen Höhlen ab. Die Kirche in der Mitte des Dorfes wird anscheinend noch genutzt. R. findet allerlei Dinge für Gottesdienste und anderes vor. Ein drapierter Altar ist noch vorhanden, Kerzen liegen für Gläubige bereit, gewebte Marien- und Jesusbilder an den Wänden. Ein alter Stuhl und ein kleiner Tisch mit Büchern an einer Seitenwand. Ein Lichtstrahl fällt durch das kreuzförmige Fenster auf den Altar. Am anderen Ende der Kirche, dem Altar gegenüber, ist ein „Stuhlkreis“ mit Steinquadern beschrieben, auf denen verschiedenfarbige Tücher liegen. Wer sich hier wohl versammelt? R. steckt drei Kerzen an für seine Lieben. Die Streichhölzer, die neben den Kerzen liegen, sind feucht. So, wie alles in diesen Höhlen und in der Kirche feucht ist. Anschließend nimmt R. die über 400 Stufen nach dem Überqueren der Brücke in Angriff, um auf den Parkplatz zu gelangen. Oben angekommen, trifft er auf zwei Französinnen, die anscheinend in der französischen Botschaft arbeiten. Kurzes Gespräch über das Dorf, dass sie bereits früher besucht haben. Mit einem der älteren Männer kommt R. ins Gespräch. Einige Brocken Deutsch und Englisch. Der Mann beglückwünscht R. zu seiner Reise und erwähnt, dass Kars und Van früher einmal armenisch waren. Sein Groll gegenüber den Türken ist unüberhörbar.
Die Fahrt geht weiter zum Kloster Tatev, einem der wichtigsten in Armenien. Es geht wieder erst die steilen Serpentinen und, um sie danach hochzufahren. Das Kloster wird gerade restauriert. Wie aber auch in anderen armenisch-christlichen Klöstern ist alles dunkel und es finden sich keine Wandmalereien. Anders als in den griechisch-orthodoxen Kirchen. Ein kurzes Gespräch mit einem der Priester über R.s Reise und seinen Aufenthalt auf Athos. Der Priester wollte wissen, ob R. Grieche sei. Nein, ist R. nicht.
Wie auch hier, fehlt es überall im Land an Geld, um die vielen historischen Stätten zu restaurieren und zu pflegen. Im nahegelegenen Lokal isst R. etwas zu Mittag, bevor er eine kleine Straße auf der anderen Talseite nimmt, die laut Navi kürzer ist. Sie wird schnell zur Schotterstraße und dann in einem kleinen Dorf zu einer erbärmlichen Piste. R. dreht um und nimmt wieder die Hauptstraße zurück.
Abends geht R. durch die Stadt Goris und findet ein kleines Lokal, in der er Essen möchte. Er ist einer der wenigen Gäste. Die Bedienung spricht gut Französisch. Sie erzählt, dass R. gerade in der Neustadt ist. Sie wurde Ende des 19. Jahrhunderts errichtet, um die Leute aus den alten Häusern und Höhlen herauszuholen, die auf der anderen Flussseite sind. Im neuen – und jetzt in Renovierung begriffenen – Stadtteil gibt es die offiziellen Gebäude (ziemlich renovierungsbedürftig), einen kleinen Park für Familien und einige Verkaufsbuden auf einem zentralen Platz. Leider fehlt es auch hier an Cafés und anderen Möglichkeiten, beisammenzusitzen und sich zu unterhalten. Kaffeeautomaten auf den Bürgersteigen sind die Regel.













63. Tag; Dienstag, 4. Juni; Fahrt nach Meghri; 180km.
Heue stellt sich die Frage, welche Route R. nach Süden, Richtung iranische Grenze nehmen soll. Die östlichste Route M2 ist die aktuelle Grenzlinie zu Aserbaidschan und verläuft ein paar Kilometer auf „feindlichem“ Territorium. Also ein „no go“. Daher wieder über die H45 nach Tatev und dann nach Südosten bis Syunik, einem hässlichen Bergbauort voller LKW und Staub. Von dort aus dann die M17 direkt Richtung Süden, erst direkt an der Grenze entlang und dann in einigem Abstand parallel dazu, bis sie weiter ins Landesinnere abbiegt. Auf der Seite des deutschen Auswärtigen Amtes werden deutsche Reisende gebeten, sich zu registrieren, wenn sie dieses Gebiet befahren. Falls man „verloren“ geht. R. ignoriert diese Vorsichtsmaßnahme. Der noch in Syunik dichte LKW-Verkehr fährt über die nun westlich verlaufende M2. Auf R.s Straße gibt es praktisch keinen Verkehr. Nur hin und wieder begegnet er einem Militärfahrzeug oder Menschen, die an der Straße arbeiten. Noch seltener Privatwagen. Nach einiger Zeit kommt ihm ein Rad-Tourist entgegen. R. hält und sucht das Gespräch. Es ist ein Italiener, der aus dem Iran auf dem Rückweg nach Europa ist. R. ist immer wieder erstaunt, welchen Menschen man begegnet. Lange Zeit kein Verkehr in dieser atemberaubenden Landschaft, die nur hier und da von einzelnen Häusern oder kleinen Dörfern durchbrochen ist. Als R. an eine alte Steinbrücke neben der Hauptstraße vorbeikommt, beschließt er anzuhalten, um sie zu fotografieren. Nachdem er ein paar Bilder gemacht hat, hört er Männerstimmen. Unter der Brücke sitzen vier Männer an einem Tisch und essen. Diese winken ihm zu und bitten ihn zu sich. Ein großes Hallo und viel Freude. Sie wollen wissen, wo er herkommt und warum er hier ist. Es entwickelt sich ein Gespräch in Englisch, Deutsch und viel Kauderwelsch. Dabei stellt sich heraus, dass zwei von ihnen in der Sowjetarmee gedient haben und in der DDR stationiert waren. Ein anderer war als LKW-Fahrer zweimal in Deutschland und der vierte kann ein paar Worte Deutsch. Sie bieten ihm zu essen und zu trinken an. Das Essen nimmt R. gerne an, hält sich mit dem Trinken (Vodka!) jedoch stark zurück. Nur ein Gläschen. Als R. wieder los will, hört er Stimmen, die von der Straße kommen, wo sein Motorrad steht. Ein paar uniformierte Männer steigen aus einem neuen, weißen Nissan Geländewagen und schauen sich die BMW an. R. ist ein wenig mulmig zumute. Was wollen die Soldaten. Er geht hin und bemerkt, dass die Männer keine Abzeichen und keine Militärstiefel tragen. Also Zivilisten. Sie interessieren sich für das Motorrad und stellen Fragen, die er leider nicht wirklich versteht. Mit Händen und Füßen geben sie zu verstehen, dass sie sich mal draufsetzen wollen und R. ein Foto machen soll. Kein Problem. R. druckt das Bild noch aus und fährt erleichtert weiter. Alles halb so wild. Es ist eher die Erwartung, die die Gedanken leitet, weniger die Realität. Zudem kennt man in Armenien fast keine Motorräder. Sieht R. welche, sind es meist ausländische Touristen. Es geht weiter auf dieser fast verlassenen Straße, von der R. nicht weiß, ob sie überhaupt freigegeben ist, da der gesamte Verkehr Richtung Süden auf der weiter westlich gelegen M2 stattfindet. Egal, läuft, weiter. Die Temperaturen steigen, je weiter er nach Süden, Richtung Iran, fährt. Er macht ein paar Fotos der Landschaft, achtet jedoch darauf, dass keine Militäranlagen zu sehen sind und immer Richtung Westen, also nicht in Richtung Aserbaidschan. Sicherheitshalber.
Am südlichen Rand Armeniens angekommen, führt die Grenze zu Iran an einem Fluss entlang. Die Grenze ist stark mit zwei Reihen Stacheldraht-bewehrten Zäunen gesichert. Fast wie die ehemalige Deutsch-Deutsche Grenze, denkt sich R. Aus dem bewaldeten Bergland ist hier eine aride Felsenlandschaft geworden. Nur rechts und links des Flusses ist es grün. R.s Ziel ist Meghri, nahe der Grenze. Nicht weit davon ist ein Grenzübergang zu Iran. Diese armenische Grenzregion zwischen Aserbaidschan und Iran wird vom russischen Militär kontrolliert. Russland ist hier die vertragliche Schutzmacht Armeniens. Sie verhalten sich bei aserbaidschanischen Angriffen jedoch neutral. Man könnte auch sagen gleichgültig. Nichts mit Schutz. Armenien hofft, dass die 3.000 russischen Soldaten nach Vertragsablauf 2025 wieder abziehen. R. zweifelt daran. Die Geschichte lässt anderes vermuten.
Das Narema Family Hotel am Ortsrand von Meghri ist noch in Bau befindlich, als R. ankommt. Der Empfangsbereich ist noch nicht fertig. Das Zimmer ist jedoch gut. Nach hinten raus gibt es einen großen Obstgarten, an dessen Ende ein kleines Haus steht, bevor es hoch geht in die kahlen Berghänge. R. kann sein Moped in die Werkstatt des Gebäudes stellen.
Er macht einen Spaziergang durch die umliegenden Gärten in Richtung der Ortschaft Pokr Tagh, gegenüber von Meghri, dass auf der anderen Flussseite liegt. Überall wachsen Obstbäume. Es geht dann etwas bergan zwischen alten Häusern zur Johannis-Kirche. Sie ist komplett restauriert und weist einen armenisch-iranischen Baustil auf. Die Wände sind mit bunten Pflanzenbildern und Szenen aus dem Leben der Heiligen bemalt.
Auf dem weiteren, steil bergab führenden Weg wendet R. sich Meghri zu. Es ist eine Mischung aus alten, mit Holzbalkonen versehenen, Steinhäusern und einigen Bauten aus der Sowjetzeit. Viele Gebäude sind in einem erbärmlichen Zustand. Auch hier fehlt Geld für notwendige Erneuerungen. In einem Lokal über dem Fluss Meghri isst R. zu Abend, bevor er wieder ins Hotel geht. Dort trifft er auf zwei junge Schweizerinnen, die gemeinsam auf dem Weg nach Myanmar sind (www.zfuess.com). Seit drei Jahren sind sie unterwegs und wollen ihr Ziel in zwei Jahren erreichen. Am nächsten Tag wollen sie nach Iran. Alles zu Fuß. 17 Paar Schuhe haben sie schon verschlissen. Mit Rucksack und Zelt; wild campen. Zwischendurch Hostels oder Hotels, um sich frisch zu machen. Gelegentlich arbeiten sie, um ihre Kasse wieder aufzufrischen. Sammeln unterwegs Müll, um ihn dann zu entsorgen. Umweltschutz ist für sie wichtig. R. hat Respekt vor ihnen. Sie sagen, dass sie überall freundlich aufgenommen werden und die Menschen ihnen gerne helfen.











64. Tag; Mittwoch, 5. Juni 2024; Fahrt nach Jerewan; 390km.
Marathon-Tour. Wollte R. eigentlich nicht mehr machen. Aber was soll’s. Er nimmt die westliche Verbindung. Voll mit LKW aus Iran und dorthin. Schritttempo die Berge hoch und runter. Permanentes Überholen.
Kapan ist chaotisch. Die LKW müssen durch die enge Stadt. Straßenarbeiten überall. Stau, warten, ausweichen. Später dann wieder der tolle Blick auf den Ararat und seinen kleinen Bruder.
In Jerewan ist der Verkehr der wahre Wahnsinn. Kilometerlange Staus, um in die Stadt zu kommen. 1. Gang. Hitze. 40°C. Schwitzen. Navi fällt zweimal aus. Handy fährt wegen Überhitzung runter. Permanent die Kupplung ziehen, bis die Finger krampfen. R. findet das Hostel nicht sofort. Ein Mann, der in Armenien und Deutschland (FFM) mit Immobilien handelt, zeigt ihm die Seitenstraße mit dem Hostel Orion. Er checkt ein und bekommt eine Schlafkabine. Nicht ganz doppelt so groß, wie das Bett. Mit Schiebetür (kein Platz für eine Schwenktür…). Moped direkt vor der Tür geparkt.
Die Stadt ist aus den Sowjetzeit. Vor etwa hundert Jahren wurde angefangen, aus Alt Neu zu machen. Zudem wurde die Innenstadt nach der Unabhängigkeit weiter „modernisiert“. Im kitschigen Stil amerikanischer Städte.
Im Vardanyan Park gibt es Licht- und Wasserspiele. Die Kinder freuen sich. Abends ist hier die Hölle los. R. schaut sich das Spektakel an und geht in ein Lokal, um etwas zu essen.
65. Tag; Donnerstag, 6. Juni; Jerewan.
Vormittags erkundet R. die Stadt und trifft dabei auf einen älteren Herren, der als Armenier in Iran (Abadan) geboren wurde und die meiste Zeit seines Lebens in den USA verbracht hat. Er kommt regelmäßig nach Armenien. Er erinnert sich gut an die erste Zeit in den USA, als er nach der Schule dorthin zum Studium ging. Ohne Geld, ohne Arbeitsgenehmigung. Er kam bei Landsleuten unter und musste dafür hart arbeiten. Jetzt, mit 71 Jahren, ist er in Rente gegangen. An seinen Landsleuten in Armenien bemängelt er vor allem, dass fast alle rauchen und so ihre Gesundheit, aber auch die Haushaltskasse ruinieren. Dafür sind die Frauen die fleißigeren Bürgen.
Nach dem Essen besucht R. das Matenadaran Museum mit seinen außerordentlichen Handschriften. Danach geht es in einer kleinen Gruppe mit einem sehr nervösen und introvertierten Guide durch die Stadt. R. hat Mitleid mit dem Stadtführer, der bei den Touristen nicht ankommt. Die Führung ist jedoch gut und die Teilnehmer lernen auch etwas über das Geschlechterverhältnis im Land. Männer sollen auf keinen Fall andere Männer anlächeln oder sich bunt kleiden, damit sie nicht als schwul gelten. Auf die Frage, ob man verheiratet ist (wird immer gestellt), auf jeden Fall mit „ja“ antworten, da man ansonsten annimmt, etwas stimme nicht mit der Person. Armenier heiraten anscheinend auch am liebsten Armenier und im Umkreis der Familie. Ein Sprichwort sagt: „Heirate lieber einen armenischen Hirten als einen ausländischen König!“.
Auf dem weiteren Weg durch die Stadt begegnet R. immer wieder Wandmalereien bzw. Graffitis. Manche davon sind künstlerisch. Sein nächstes Ziel ist die große, blaue Moschee aus dem 18. Jahrhundert. Die iranische Regierung hat die Anlage restauriert. Absolut sehenswert. Im Garten des Innenhofs herrscht eine angenehme Stille.
Abends geht R. in die Oper und schaut sich eine Ballettaufführung an (Masquérade von Khachaturian). Die Darbietung ist klassisch und gut. Neben R. sitzt eine kopftuchtragende Ägypterin aus Gizeh. Von ihrer Wohnung aus hat sie einen Blick auf die Pyramiden. R. möchte wissen, warum sie nach Armenien fährt und nicht nach Europa? Für sie ist es einfacher, ein Visum für Armenien als für die Schengen-Region zu bekommen. Sie findet Armenien schön und westlich zugleich.













66. Tag, Freitag, 7. Juni 2024; Fahrt nach Alaverdi; 200km.
Das Navi macht weiterhin Probleme. Geht immer wieder aus. In Sevan am See trifft R. die beiden Südtitoler in ihrem Iveco wieder, die er in Doğubayazit getroffen hat. Sie erzählen, dass das Debed Tal, in dem sich Alaverdi befindet, R.s Ziel für heute, von Hochwasser verwüstet wurde. R. bleibt seinem Vorhaben trotzdem treu.
Nicht weit nördlich des Sewan Sees macht R. am Haghartsi Kloster hlt. Eines der vielen alten Klöster Armeniens. Dieses ist gut restauriert. Und leblos. Nur Touristen, die Kerzen anzünden.
Er fährt weiter nach Dilijan durch eine wunderschöne Berglandschaft. Die Gewitterwolken lassen den Himmel und die Gegend noch schöner erscheinen, zwingen R. aber zu einer zügigen Weiterfahrt. Alaverdi liegt nahe der Georgischen Grenze. R. biegt falsch ab und steht vor dem Grenzposten. Der erklärt ihm den richtigen Weg und R. dreht um, um eine andere Straße zu nehmen. Er fährt durch das von Hochwasser total zerstörte Tal. Straßen sind teilweise weggespült, Häuser zusammengebrochen, Eisenbahnschienen hängen über dem Fluss in Leeren. Die Brücke nach Alaverdi ist gesperrt, da große Teile fehlen. Also bis zur nächsten Brücke fahren und auf der teilweise schlammigen Landstraße wieder zurück in die Industriestadt, die einer Geisterstadt ähnelt. Kurz vor Ankunft in der Unterkunft gibt es einen heftigen Regenguss und R. kommt bis auf die Knochen durchnässt im Alaverdi Guest House, das an einer sehr steilen Straße liegt, an.
Abends geht R. in der trostlosen Stadt durch die Straßen. Das Tal lebte vom Bergbau und von der Metallverarbeitung. Ein riesiges Hüttenwerk liegt wie ein eingeschlafenes Saurier am Stadtrand. Verlassen, verrostet, verfallen.








67. Tag; Samstag, 8. Juni; Alaverdi und Debed-Tal; 100km.
Hier im Tal und in der Umgebung liegen einige christliche Klöster, die teilweise auch Weltkulturerbe sind. Sanahin und Haghipat liegen in der Nähe und sind einfach zu besichtigen. Das schlechte Wetter macht R. einen Strich durch die Rechnung. Er kann sein Programm nur teilweise umsetzen. Sanahin ist wirklich sehenswert. Wie viele Kirchen und Klöster sind auch diese Gebäude dunkel und feucht. Wie muss es hier vor 1.000 Jahren ausgesehen haben, als noch Mönche da waren? Im Ort gibt es zudem das Museum der Gebrüder Mikoyan, die entscheidend an der Konstruktion der MIG-Jäger beteiligt waren. Der Name „MIG“ leitet sich von „Mikoyan“ „und“ „Gurewitsch“ ab, den beiden Hauptakteuren. Der Bruder des Konstrukteurs Mikoyan war Kampfpilot und testete die Flugzeuge. Im Garten des Museums steht ein alter Kampfjet.
Im zweiten Kloster, in Haghipat, regnet es dermaßen, dass R. im benachbarten Restaurant zu Mittag ist. Busse mit Touristen kommen an , um die Anlage zu besichtigen und versuchen, nicht allzu nass zu werden. Im Restaurant unterhält R. sich mit einem irischen Ehepaar, das mit einem einheimischen Fahrer unterwegs ist. Auch in Irland gibt es aktuell Überschwemmungen. R. ist nicht überrascht. Den Fahrer fragt R., warum es in Armenien so wenig Tee- oder Kaffeestuben gibt. Er meint, dass das nicht zur hiesigen Kultur gehöre. Der Kaffee kam erst mit den Armeniern, die das osmanische Reich bzw. die Türkei verlassen haben, ins Land.
Nachdem der Regen aufgehört hat, fährt R. das Tal hoch. Überall Hochwasserschäden! Wie im Arntal, dass R. mit Freunden im Jahr zuvor besucht hatte.
Auf dem Rückweg nach Alaverdi kommt R. an zerstörten Restaurants vorbei. Er hält an, steigt vom Motorrad und sieht sich die Katastrophe an. Der Schlamm liegt teilweise noch 50cm hoch. Menschen versuchen die Gebäude und die Plätze darum aufzuräumen und zu säubern. Auf der dem Fluss zugewandten Seite des Restaurants fehlt eine Wand. Nur das Regal mit den Reserven und Konserven, die bunt im Regal stehen, ist noch vorhanden. Eine Frau, vielleicht die Besitzerin, zeigt ihm die Küche, in der das Wasser bis über die Tür Stand. Der Fluss war 6m über die Normal gestiegen. Die Büsche und Bäume ringsherum haben keine Blätter und auch keine Rinde mehr. Die Strömung halt sich „geschält“.
Der ganze Ort war vor der Flutkatastrophe bereits vom Untergang gezeichnet. Das Wasser hat ihm den Rest gegeben. R.s Vermieter sagt, dass seine Firma (das Hüttenwerk) zugemacht hat, in dem er gearbeitet hat. Er hat Jura in Sankt Petersburg studiert. Die meisten Arbeiter sind nach Jerewan oder ins Ausland gegangen. Das einzig Gute an der Pleite ist, dass die Luft besser geworden ist.




























68. Tag; Sonntag, 9. Juni 2024; Fahrt nach Tiflis/Tblissi; 120km.
R. fragt sich, wie lange er diesmal wohl an der armenischen Grenze brauchen würde? Auch wieder zwei Stunden, wie bei der Einreise? Diesmal jedoch kostet es ihn nur kurze zwanzig Minuten.
Unterwegs triff R. noch ein französisches Paar aus Toulouse auf ihren Fahrrädern und unterhält sich kurz mit ihnen. Es sind nicht die einzigen Radler-Touris, die er auf seinem Weg in die georgische Hauptstadt antrifft. Gegen Mittag kommt er in Tblissi an. Das Navi fällt wieder mehrfach aus und R. muss anhalten, bis es wieder anspringt. Es ist wieder sehr heiß. Es findet sein Hostel, das in einem Innenhof liegt und man nicht sagen könnte, ob es 100 oder 200 Jahre alt ist oder vielleicht noch älter. Es könnte eine Filmkulisse für historischen Filme sein.
Die Stadt ist ganz anders als Jerewan. Sie hat ihren ursprünglichen Charm bewahrt und wirkt trotzdem jung. Die Straßenzüge sind historisch und einige Viertel sind noch richtig alt. Es gibt enorm viele junge Leute und noch mehr Touristen aus aller Welt. Viele von ihnen sind aus Russland. Später erfährt R., warum sie hier sind.
69. Tag; Montag, 10. Juni 2024; Tbilissi/Tiflis.
Fast alle Gebäude des 19. Jahrhunderts stehen noch in Tiflis. Etliche sind allerdings in einem schlechten Zustand, teilweise eingestürzt. Es erinnert ein bisschen an Berlin nach der Wende. Maroder Charme gesellt sich zu hippen Straßenzügen und einer restaurierten Altstadt. Viele Häuserblöcke haben große Innenhöfe, in denen man zum Teil über offene Holztreppen und Holzbalkone zu den Wohnungen geht. Kinder toben und spielen dort unbefangen herum. R.s Hostel befindet sich in einem derartig verwunschenen Innenhof der Altstadt.
Auf der anderen Flussseite stehen viele Prestigebauten, alt und neu. Genutzt oder ungenutzt.
Über der Stadt thront die große Burgruine mit einem wunderbaren, sie umgebenden Park, durch den Einheimische und Besucher flanieren, sich ausruhen oder einfach die Zeit genießen. Der ständige Regen hat aber auch hier zu Erdrutschen am Burghang geführt. Im Viertel um die Burg herum gibt es noch viele alte Häuser mit großen Holztreppen und mächtigen Balkonen, auf denen man auch schlafen könnte. Nicht weit davon gibt es eine kleine, aber sehr alte Tempelanlage des zoroastrischen Feuerkults, der aus dem Iran stammt. R. und ein weiterer Tourist klopfen beim Besitzer an, um Einlass zu erhalten. Es ist leider nur eine Wand des Tempels erhalten. Schwer vorzustellen, wie es ursprünglich mal ausgesehen haben muss.
Viele der zahlreichen Touristen kommen anscheinend aus Russland. An den Häuserwänden wurden neben der georgischen die europäische Flagge gemalt, als Erinnerung für die Versprechen der Regierung, die sich aktuell wieder mehr dem großen, nördlichen Nachbarn widmet, der immer noch etliche (separatistische) Gebiete im Kaukasus besetzt hält. Die Flaggen werden durch Sprüche ergänzt, wie „Fuck Russia“. Eindeutige Aussage eines Gefühls.
Nahe dem im osmanischen Stil gehaltenen Badehaus posiert ein Brautpaar vor R., der sich diese Gelegenheit für ein Foto nicht entgehen lässt. Es wird heute nicht das einzige sein. Nicht weit davon, an einer mit unzähligen, meist roten, Schlössern behangenen Brücke fotografiert eine junge Frau mit freiem Bauch und einem sehr freizügigen Rock eine andere, ebenfalls junge Frau mit goldfarbenem Kopftuch und langem, blauen Umhang. So unterschiedlich können Menschen sein.
In einem Gartencafé sitzen junge Leute und arbeiten an ihren Laptops. Ein großer Schäferhund liegt vor ihren Füssen und hechelt in der Hitze des Tages. In einem Innenhof eines Klosters spielt eine komplett in Schwarz gehüllte Nonne mit einer Französischen Bulldogge Fußball, bis sie R. dabei erwischt, wie er sie fotografiert. Das mag sie nicht.
Abend in einer Kneipe begegnet R. drei französischen Bikern, zwei Männer und eine Frau. Sie sind auf nicht mehr ganz frischen Mopeds unterwegs nach Kirgistan über Russland und nehmen sich dafür sechs Monate Zeit. Probleme machten die Bikes bisher nicht, nur die riesigen Schäferhunde, denen sie mehrmals entkommen mussten. Schwierig wird es, wenn mehrere solcher Giganten auf die Fahrer losgehen.
















70. Tag, Dienstag, 11. Juni 2024; Tiflis.
R. geht heute Vormittag die Prachtstraße entlang. Sie stammt noch aus einer Zeit, als Georgien zum Zarenreich gehörte. Das Land war und ist ein Schmelztiegel der Kulturen und Völker. Da auch die Seidenstraße hier entlangführte (in Tiflis gibt es noch eine alte Karawanserei), trafen sich Ost und West hier südlich des Kaukasus.
Nachmittags nimmt R. an einer Stadtführung mit einem Journalisten teil. Er liebt die freie Rede und unterhält die Gruppe auf angenehmste. Na ja, er ist schon sehr von sich eingenommen, denkt sich R.. Der Ausgangspunkt ist das riesige Hostel „Fabrikka“, das in einer früheren Fabrikhalle eingerichtet ist und mal von Russen gebaut wurde. In diesem Viertel waren früher auch viele Schwaben angesiedelt, die vor allem als Handwerker arbeiteten. Der Guide lässt kein gutes Haar an Russland. Seine Familie musste im letzten Krieg gegen Russland aus ihrer Heimatregion flüchten.
71. Tag; Mittwoch, 12. Juni 2024; Fahrt nach Sighnathi und R.s Geburtstag.
Morgens geht R. Hundefutter kaufen. Am Stadtrand in Richtung des Tierheims, aus dem seine Tochter eine Hündin namens Laïma bezogen hat, findet er eine Zoohandlung und kauft 15kg Futter für umgerechnet 70€! Hundebesitzer in Georgien müssen reich sein. Er bringt den Beutel Futter zum Tierheim, in dem gerade niemand Zeit hat (die Ansprechpartnerin seiner Tochter ist heute nicht da) und legt ihn am Eingang ab. Einige der vielen Hunde (hunderte?) kommen zu R. und freuen sich über seinen Besuch. Auch vor dem Heim sind Hundehütten für freilaufende Hunde ausgestellt und besetzt.
Es geht weiter nach Nimotsminda bei Sagarejo. Zu einer Wehrkirchenruine mit gepflegtem, prachtvollem Garten. R. ist nicht der einzige Besucher. Frauen kaufen Kerzen und zünden sie an. Beten.
Auf dem weiteren Weg begegnen ihm mit einem Mal Ortsschilder mit deutschen Namen darauf, wie „Petersdorf“. Verdutzt hält R. an. Ein Mann hält mit seinem Auto neben ihm an und gibt ihm zu verstehen, dass er ihm folgen solle. Er führt ihn zum deutschen Friedhof. Alte Gräber. Keine neuen.
Sein nächster Halt ist das Dawid Garetscha Kloster bei Udabno. Die Anlage liegt an einem Hang, der die Grenze zu Aserbeidschan markiert. Nur Teile sind zugänglich. R. spricht kurz mit den beiden Soldaten, die sowohl die Anlage als auch die Besucher überwachen. Nur nicht über den Hang gehen. Nur bis zur Quelle im Felsen. Und bitte dann auch zurückkommen, um sich wieder bei ihnen zu melden. Ordnung muss sein.
Das Navi zeigt eine direkte Verbindung zum eigentlichen Ziel, Sighnaghi. Es ist keine Straße im westlichen Sinne. Es ist ein Schotterweg. Es muß die letzten Tage viel geregnet haben. Große, tiefe Wasserlöcher zwingen R. zum Slalomfahren. Manchmal durch die Büsche am Wegesrand. Wer weiß, wie tief die Löcher sind und was da drin ist. Kein Risiko. Es gibt auf den 10km nur ein Fahrzeug, das ihm begegnet.
In Sighnaghi hat R. eine private Unterkunft, die alles bietet, gute Zimmer, Familienanschluss und viel zu viel zu essen. Ein Pärchen ist russisch-ukrainischer Herkunft, ein Architektenehepaar schottisch-englischer und dazu noch zwei englische Studentinnen, die gerade ihr Studium in Philosophie bzw. Geschichte absolviert haben.
Abend kam dann noch der Cousin aus Tiflis und die Familie mit Freunden hat auf der Veranda bin in die Nacht ordentlich gebechert.



72. Tag; Donnerstag, 13. Juni 2024; Sighnaghi.
Einen Tag Faulenzen. Das ist der Plan. R. setzt in genüsslich um. Spazierengehen zum Friedhof auf dem Bergrücken inklusive kleine, alte Kapelle mit ein paar Utensilien und vielen Marien- und Heiligenbildern bzw. Ikonen. Manche sind auf Papier gemalt und liegen auf dem Fenstersims oder am Boden, an die Wand gelehnt. Es ist nicht erkennbar, ob die Kapelle noch regelmäßig genutzt wird. An einem steilen Weg in der Nähe sieht R. ein größeres Gebäude, das wie ein Hotel aussieht. Er schaut es sich näher an. Verlasse. Nie fertig geworden. Die Tür steht offen. Das Treppenhaus hat kein Geländer oder besser gesagt, jemand hat aus Ästen ein wenig vertrauenswürdigen Geländer gebaut und mit Schnüren zusammengebunden. Drei Etage geht R. hoch. Es hält. Oben ist jemand. Wohnt anscheinend hier und nimmt für die Aussichtsplattform ein Trinkgeld.
Die kleine Stadt auf dem Berg ist hübsch hergemacht und bei Touristen beliebt. Sie kommen Bus-weise. Die Häuser sind meist gepflegt und haben große hölzerne, oft intensiv blaue Balkone.
Zurück in der Herberge schmort der Wirt noch im eigenen Saft und versucht, zu den Lebenden zurückzukehren. Es wird noch etwas dauern, bis seine Sinne wieder nutzbar sind.
Die Wirtin serviert ein großartiges Abendessen. Die Gäste unterhalten sich lebhaft und tauschen Erfahrungen und Lebensphilosophien aus.
73. Tag; Freitag, 14. Juni 2024; Fahrt nach Telavi; 200km.
Das östliche Georgien ist für seine Nationalparks bekannt. R. will in den Vashlovani Nationalpark. Wie sich jedoch herausstellt, ist dieser Nationalpark für Motorräder gesperrt. Zu viele Enduristen haben zu viel Mist gebaut (querfeldein gefahren) und so ist der Park für diese Kategorie von Fahrzeugen gesperrt! In der Nationalparkverwaltung trifft R. einen 70jährigen Rostocker mit seinem VW-Camperbus. Er war vorher in Omalo, d.h. in den Bergen. Dort will R. auch hin. Die Strecke ist jedoch extrem schlecht und bei Regen nicht zu empfehlen. Das ist dem Mann auch passiert. Ihm war der Schwierigkeitsgrad nicht bewusst. Unterwegs hatte er zwei Platten, die er nur mit allergrößter Mühe reparieren konnte. Der Mann ist medizinisch gesehen in der Palliation und wurde von seinen Ärzten aufgegeben. So hat er sich den Camperbus gekauft und befindet sich – nach seinen Worten – auf seiner letzten Reise…
Nachdem R. nicht in den Nationalpark fahren darf, entschließt er sich, in den Chachuna Nationalpark zu fahren, nahe der aserbaidschanischen Grenze. Die entsprechenden Genehmigungen erhält R. bei der Nationalparkbehörde und der Grenzschutzpolizei. Los geht die Fahrt. Aus der Asphaltstraße wird schnell eine harte Sandpiste. Vor ihm liegt dann ein sehr langer und abschüssiger Abschnitt, der ihn zu seinem Ziel, einem See, an dem er Zelten möchte, bringen soll. Im Hintergrund bauen sich derzeit riesige Gewitterwolken auf. R. hält an und sieht sich den Feldweg genauer an. Was, wenn es wieder stark regnen sollte? Käme er dann diese elendig lange Auffahrt (ca. 500m) wieder hoch. Die Auswaschungen des letzten Regens sind noch zu sehen und mit Straßenreifen sieht R. keine Chance, bei Regen hier wieder zurückzukommen. Also am Ende der Abfahrt kehrt machen. Wieder einmal. Das ist der Nachteil, alleine mit solchen Reifen unterwegs zu sein Zu zweit könnte man sich gegenseitig helfen. Enduroreifen würden das Fahren auf diesem Untergrund einfacher machen. Jedoch fährt R. den Großteil seiner Route auf der Straße. Da bringen die Enduroreifen dann nicht. Einen Tod muss man sterben…
R. fährt dann über Lagodechi am Kaukasus entlangnach Telavi. Auf dem Weg kommt er bei Gremi an der Burg der Herrscher des Kahketi-Königreichs vorbei und besichtigt sie. Kleine Burg. Kleines, aber früher einflussreiches Reich. Heute wird die östlichste Provinz Georgiens danach benannt. Die Portraits der Herrscherfamilie befinden sich in der Burg. Sie ähneln den blass-weißen Mitgliedern der Addams-Familie aus dem Fernsehen und sind allen Anschein nach „kachektisch“. Daher der Name? R. nimmt an, dass der Maler danach geköpft oder in die Verbannung geschickt wurde.
In der Burgkapelle findet eine Taufe statt. R. sinniert über die beiden Begegnungen des Tages: der totkranke Mann und der frisch getaufte Säugling. Beginn und Ende des Lebens. .
Telavi ist eine etwas lieblose, größere Stadt. Die Unterkunft ist jedoch super. Ein renoviertes Einfamilienhaus mit riesigem Wohnbereich und moderner Küche für alle Gäste. Abends kommen noch eine Reiseleiterin und ihr Fahrer hinzu. Sie unterhalten sich. Beide sprechen Deutsch und R. erwähnt, dass er gerne die Reifen wechseln möchte. Der Fahrer sagt, dass er sich darum kümmern werde.
Da die Wirtin anbietet, gegen Gebühr Sachen zu waschen, gibt R. ihr einen Haufen Wäsche und den Motorradanzug.
74. Tag; Samstag, 15. Juni; Telavi; 50km.
Beim Frühstück kommt der Fahrer auf R. zu und gibt ihm eine Adresse in Tiflis für gebrauchte Reifen. R. soll dorthin fahren, wenn er in Tiflis ist. R. freut sich über die Hilfsbereitschaft.
Im frisch gewaschenen Motorradanzug fährt R. in ein nahes Kloster nach Alaverdi (diesen Ortsnamen gibt es anscheinend nicht nur in Armenien). Es ist gut erhalten (wurde vor einigen Jahren restauriert) und wird sehr gepflegt. Um das Kloster herum gibt es Wein und Landwirtschaft. Anschließend zu dem kleineren Kloster Ikalto aus dem 6. Jahrhundert, dass für seinen Wein bekannt war. Überall auf dem Gelände der Anlage liegen Amphoren (bis 1.000L) herum und bezeugen die Historie. Die Anlage ist nicht so gut erhalten und das Innere der Kirche wird von massiven Stahlträgern vor dem Einstürzen bewahrt. Nachmittags besichtigt R. die Stadt, die alte Burganlage und das Kloster. Es ist ein ruhiger Tag. Entspannung findet er anschießend im schönen Garten der Unterkunft.






75. Tag; Sonntag, 16. Juni 2024; Fahrt nach Stepansminda; 180km.
Eine Rudel Schweine, halb domestiziert, halb wild, laufen am Straßenrand entlang und fressen auf der Wiese. Richtung Russland. Auf der Heerstraße nach Norden. Zuerst ist die Straße gut ausgebaut. Dann wird R. von seinem Navi östlich um einen großen Stausee geleitet. Auf einer schmalen Straße, die dann zu einem schlechten Schotterweg ohne absehbares Ende in einen Wald mit steilen Hängen wird. R. dreht um und fährt die landschaftlich schöne Strecke zurück, nicht ohne erst einen Kaffee in einem am Straßenrand gelegenen Lokal zu trinken. Etwas später setzt sich R. in eine bessere Imbissbude mit Gartenstühlen, um etwas zu essen. Dort trifft er auf eine Reisegruppe mit Jugendlichen, die sich für sein Moped interessieren. Es werden Fotos gemacht. R. macht Fotos mit den Jungen und Mädchen vor dem Motorrad. Er überspielt die Fotos auf das iPhone eines der Mädchen und so haben sie auch ein Souvenir. Die Straße windet sich teils im Tal, teils in dessen steilen, bewaldeten Hängen nach Norden. Hauptverkehrsstraße nach Russland. Mancherorts ist die Straße so schmal, dass die LKW anhalten müssen, um die anderen passieren zu lassen. Auf der stark befahrenen Straße schleichen die Laster bergauf und bergab. Im Kriechtempo, wenn es zu steil wird. Mit der BMW hat R. dann keine Probleme zu überholen. Viele Autos können das nicht und es bilden sich lange Schlangen hinter den LKW. An einem großen Platz, auf einem Plateau, steht ein gigantisches Denkmal. Das Denkmal für die georgisch-russische Freundschaft. Aus Sowjetzeiten. Stalin war Georgier. Hier halten alle Touristen an. Machen Fotos. Selfies. R. auch. Von der verordneten „Freundschaft“ ist nicht mehr viel übrig.
Bevor R. zu seiner Unterkunft in Stepansminda fährt, nimmt er die letzten Kilometer bis zur georgisch-russischen Grenze. Etwas oberhalb des Ortes ist eine Kirche mit großem Parkplatz. Von dort aus kann R. die georgische Grenzanlage sehen. LKW stehen davon und warten auf Abfertigung. Das Tal ist tief und eng eingeschnitten. Hinter der nächsten Biegung befindet sich der russische Grenzposten. Außerhalb seiner Sicht.
Zurück nach Stepansminda. Die Unterkunft gehört dem Sohn des Vermieters vom Vortag in Telavi. Neues, kleines Hotel mit Selbstversorgung. Sehr schön eingerichtet. Vom Zimmer aus kann R. die Berge sehen. Den Kasbegi, Georgiens dritthöchster Berg mit 5054m. Der Sage nach soll hier Prometheus angekettet worden sein, nachdem er dem Menschen das Feuer geschenkt hatte. Zu spät; sie hätten ihn vorher anketten sollen. Jeden Abend soll ihm dort ein Adler ein Teil der Leber herausgerissen haben, die dann nachwuchs. Herakles hat dann seine Ketten gesprengt und ihn somit von seinem Schicksal erlöst.
Die Ortschaft hat nichts zu bieten außer viele Hotels und eine grandiose Landschaft. Viele der älteren Häuser sind in einem sehr schlechten Zustand, halb verfallen. Die Straßen im Altort sind meist aus Schotter, teils mit tiefen Rillen oder hohen Stufen, über die nicht einmal Autos fahren können.






76. Tag; Montag, 17. Juni 2024; Fahrt zurück nach Tiflis; 190km.
Die Kirche auf einem Berg mit dem Kasbegi im Hintergrund ist ein lohnendes Fotomotiv und das lässt R. sich nicht entgehen. Nach der Abreise geht es die beiden Seiten des Tals auf engen, steilen, gewunden Straßen hinauf, um die Kirchen zu fotografieren. Es sind am Vormittag schon recht viele Leute unterwegs. Fröhlich, in Gruppen oder als Familien. Vor allem. Vor einer der Kirchen fotografiert ein Mann seine Frau. Wie üblich, macht auch R. ein Foto des „Models“. Mit Hut. Auf der von unzähligen Blumen übersäten Wiese. Vor der Trinitatis-Kirche geht ein orthodoxer Priester mit gesenktem Kopf an R. vorbei. Die Kirche wird gerade renoviert und überall stehen Gerüste. R. stößt sich daran den Kopf. Nicht nur er. In der Kirche erleuchtet ein messerscharfer Lichtstrahl, von der Kuppel kommend, eine lebensgroße Ikone.
Die anschließende Rückfahrt auf der Heerstraße empfindet R. als nervig. Die vielen langsamen LKW sind bergab schwieriger zu überholen als auf dem Weg bergan. R. versteht nicht wirklich, woran das liegt. Er nimmt zwischendurch eine parallele Schotterstraße, die im Nirgendwo endet. R. fährt wieder auf die Hauptstraße.
In Tiflis angekommen, ist es sehr heiß. 35°C. R. sucht den empfohlenen Reifenhändler, findet ihn unter der Adresse aber nicht. Die Adresse ist ein Innenhof einer älteren Hochhaussiedlung. Dann weiter zum Superhostel von Tiflis: Fabrika. Eine alte, umgebaute Fabrik mit großem Hinterhof, in dem Restaurants und Kneipen sind. Es ist viel los. Junge Leute vor allem. In der riesigen Empfangshalle arbeiten viele von ihnen an ihren Laptops. Digitale Nomaden. Nach dem Einchecken will R. noch einmal versuchen, den Reifenhandel zu finden, um Enduroreifen draufziehen zu lassen. Sein Moped steht neben einer Reihe anderer. Unter anderem eine Harley Davidson. Beim Starten seiner BMW löst das Grummeln den Alarm der HD aus. R. Kurios. R. probiert es noch einmal aus. Es funktionier wieder. R. und einige andere, die neben ihm stehen, sind amüsiert. R. kann den Reifenhändler wieder nicht finden. Er telefoniert mit dem Mann, der ihm die Adresse gegeben hatte. Hilft nichts. Nicht zu finden. Genervt. Unterwegs hilft R. noch einem Harley Fahrer, der keinen Sprit mehr hat. Er gibt ihm den aus seiner Kocherflasche.
Im Hostel ist R. zusammen mit zwei jungen Türkinnen in einem Zimmer. Als er reinkommt, ist eine davon gerade in ein Handtuch gehüllt, da sie anscheinend vom Duschraum kommt. Er. ist höflich und zieht sich zurück.







77. Tag; Dienstag, 18. Juni; Tiflis.
Heute dritter Versuch, einen Reifenhändler zu finden. Der Kontakt sagte R., er solle warten, wo er gerade ist. In einem kleinen Gartenlokal nahe der Adresse. Der Mann würde kommen. In drei Stunden oder so, da er unterwegs ist. R. bedankte sich und sagt ab. In dem Lokal sind ein paar deutsche und niederländische Männer, die sich mit einer gut gekleideten Frau unterhalten. R. bekommt mit, dass sie zu einer UN-Abteilung gehören (bzw. von der UN beauftragt sind), die die russischen Aktivitäten im besetzten Norden des Landes beobachten. R. unterhält sich kurz mit ihnen, bevor sie gehen.
R. schaut im Internet, wo es in Tiflis andere Reifenhändler gibt. Er findet einen in einem Handwerker- und Händlerviertel, der einem modernen Bazar ähnelt. Zumindest sieht es so auf Google-Maps aus. Also fährt er hin. Der Verkehr ist eigentlich eine Art Stopp & Go und eher ein Parkplatz als eine Strasse. An diesem „Bazar“ angekommen, findet R. keine Einfahrt in das Gewirr aus kleinen Gassen. Das Ganze mutet eher einem riesigen Flohmarkt mit Buden und Geschäften an als einem Industriegebiet. Er fährt zweimal im Schritttempo um den großen Komplex herum. Ohne Erfolg. Anscheinend kommt man nur zu Fuß hinein in dieses chaotische Viertel. Überall sieht R., wie Fahrzeugteile gehandelt werden, aber es gibt keine Zufahrt. Es gibt auch keine Parkmöglichkeit, nicht einmal für ein Motorrad. Frust. Nur weg. Dann eben keine anderen Reifen. Zurück zum Hostel. Nach vier Stunden Reifensuche kommt er dort wieder an. Fix und fertig. Duschen, Bier im Hof trinken gehen. Etwas Musik hören. Er sieht die beiden Türkinnen aus Istanbul wieder, die am Morgen in ein anderes Hostel in der Innenstadt umgezogen waren. Sie sind wieder da, weil im anderen Hostel und den umgebenden Gebäuden das Wasser ausgefallen war. Sie verabreden sich zum Abendessen.
Dort erfährt R. mehr über sie. Sie wohnen zwar in Istanbul, kommen aber aus Kars und Izmir. Dort haben sich beide beim Anglistikstudium kennen gelernt und arbeiten nun als Lehrerinnen in der Megametropole. Sie reden über die aktuelle Situation in der Türkei und das Wahlverhalten der Türken in Deutschland, die häufig für die aktuelle, ultrakonservative Regierung stimmen.
Die beiden Frauen bestätigen R.s Eindruck, dass es schwierig ist, mit Einheimischen Kontakt zu finden. Das verwundert auch sie. Anschließend sitzen alle drei mit einem anderen Türken im Hof des Hotels und trinken noch etwas. Der junge Türke will als Tennis Coach in Georgien arbeiten. Er hat aber Schwierigkeiten, eine Arbeitsgenehmigung dafür zu erhalten.
Am Ende des Abends machen R. und die beiden Frauen in der Eingangshalle des Hostels noch eine Fotosession. Das findet die Rezeptionistinnen nicht so gut. Sie sagen, dass das nicht erlaubt sei. R. wendet ein, dass es kein professionelles Shooting ist. Sie entgegen, dass er doch eine professionelle Kamera habe. Er macht noch ein paar Bilder und hört dann auf.





78. Tag; Mittwoch, 19. Juli 2024; Fahrt nach Kutaisi; 270km.
Erst spät fährt R. los. Fährt noch mal in die Stadt, um bei einem Motorradladen („Bikeland“) nach Reifen zu fragen. Sie haben Enduroreifen, aber nicht in der richtigen Größe. R. kauft aber Endurohandschuhe, da seine dicken viel zu warm sind. Sie kosten genauso viel wie in Deutschland! Wer kann sich so etwas leisten, wenn die Gehälter hier nur ein Bruchteil dessen sind, was man in DE verdient?
Die zweite Hälfte der Fahrt fand R. landschaftlich reizvoll. In Kutaisi angekommen, quartiert er sich im Hostel „Black Tomato“ ein. Ist ein gutes Hostel. Abends gibt es Fußball. Weltmeisterschaft. Gäste aus aller Welt sind hier. Warum aber fährt man hierher, außer auf Durchreise zu sein?
Keine Fotos gemacht.
79. Tag; Donnerstag, 20. Juli 2024; Fahrt in den Kaukasus; 170km.
Es gibt Orte, an denen R. nicht wohnen will. Auf der Fahrt in den Kaukasus kommt R. an einem ehemaligen, alten, früher vor allem von Russen frequentierten Kurort vorbei. Die Russen sind seit langem weg. Die Gebäude verfallen. R. hält nur kurz an, um etwas zu trinken. Er will versuchen, über Lenteghi nach Ushguli zu fahren. Über die unbefestigte Passstraße. Dafür wären die Enduroreifen gut. Kurz vor Lenteghi gab es einen Erdrutsch (vorher mehrere kleine, die bereits weggeräumt waren). Es hat sehr viel geregnet. R. hält vor dem Bagger an, der die Erde wegräumt und sieht zu, wie die Autos durch die knietiefen Wasserlöcher fahren. Auf dem Weg hierher kamen ihm Biker entgegen. Mit Enduroreifen. Er hat keine. Der Baggerfahrer signalisiert ihn, er solle durchfahren. R. schüttelt den Kopf. Weichei. Ausreden, Gründe hat er viele. Auch gute. Trotzdem Weichei. Nun gut, es gibt noch eine andere, bessere Route über Mestia.
R. beschließt, nach Kutaisi zurückzufahren. Er nimmt wieder das gleiche Hostel.
Auf dem Weg zurück fährt er durch ein anderes Tal, das Roni Tal. Die Piste ist zum größten Teil noch geschottert und durch den Regen in einem schlechten Zustand. R. kommt trotzdem gut klar. Auch mit Straßenreifen. Unterwegs trifft er auf eine Radfahrerin und hält an. Unterhält sich mit ihr. Sie ist aus Berlin. Ihr Partner ist weiter vorne. Sie machen Mountainbike-Urlaub. Sie findet die Straße scheiße. Frustriert. Sie hat nicht damit gerechnet, solche Schotterstraßen fahren zu müssen. Stundenlang. Steine, Schlamm, Pfützen. Bergauf, bergab.
Auf der Fahrt hat R. ein paar Wasserfälle fotografiert. Nicht spektakulär, aber schön.
Abends im Hostel mit der Bedienung unterhalten. Sie hat mal mit Deutschland einen Austausch gemacht und spricht ein paar Worte Deutsch. Im Hostel-eigenen Bistro sitzt eine Schweizerin, die an ihrer pädagogischen Dissertation schreibt. Man muss nur die Idee haben, es hier zu schreiben, denkt sich R. Er hat jahrelang dafür im Labor gesessen.






80. Tag; Freitag, 21. Juni; Fahrt nach Zugdidi; 120km.
Es geht Richtung Küste, um dann nach Norden in den Kaukasus abbiegen zu können. Schon in der Nacht hat es viel geregnet. Am Vormittag geht es so weiter. R. zieht Regensachen an.
Zuerst steuert er wieder die alte Kur- und Sanatoriumsstadt an, Tskaltubo. Sie ist bekannt für ihre „Lost Places“. Leider sind die meisten Bauten durch hohe und nicht überwindbare Metallzäune gesichert. Ein paar kleinere sind noch zugänglich. Er geht zum Bad 5 und fotografiert. Kurz nach ihm kommt noch eine junge Frau mit einem Fotoapparat. Sie sehen sich von weitem und versuchen, dem jeweils anderen nicht im Weg zu stehen. Als nächstes fährt er zum Metallurgen-Sanatorium. Wäsche hängt an den Fenstern. Einige Teile des großen Gebäudes, das vom Anfang des 20. Jahrhunderts zu stammen scheint, sind bewohnt. Als R. vom Motorrad steigt und zum Haupteingang geht, kommt eine alte Frau aus ihn zu und möchte Eintrittsgeld. Wohl eine Art selbsternannte Block-Wächterin. Sie hat ihren Stuhl direkt hinter der Eingangstür und lässt sich mein Interesse an dem Bau bezahlen. Nur eine geringe Summe für mich. Ok. Es lohnt sich für ihn. Er macht einige schöne Aufnahmen vom Innenraum und der mittlerweile auf ihrem Stuhl eingeschlafenen Wärterin. Es geht weiter nach Khoni. Aber am Ortsausgang wird der Regen zum Sintflut-artigem Unwetter mit Gewitter. Das Wasser läuft in Strömen die Straße hinunter. R. hält an einer alten Bushaltestelle in modernen Betonstil der Sowjetzeit an. Schön bunt gewesen. Ein Auto hält an und fragt, ob er mitkommen möchte zu ihm auf einen Kaffee. Es ist ernst gemeint. R. wiegelt jedoch ab, da ihm ansonsten danach die Zeit fehlen wird. Sobald der Regen nachlässt, fährt R. weiter. In Koni hält er an und isst im Café eines Supermarkts etwas. Er verbringt dort viel Zeit, weil ein schweres Gewitter über die Stadt niedergeht. Die Donner sind so stark, dass die Scheiben des Supermarkts wackeln. In der Bäckerei gibt es sogar eine traditionelle Brotbäckerei. R. schaut dem Bäcker zu, wie er das Brot in dem Amphoren-artigen Steinofen backt. Der Regen hat nachgelassen, das Gewitter aufgehört und R. fährt weiter. Am Straßenrand immer wieder Schweine. Dunkel und mit vielen Borsten. Auf den an die Straße grenzenden Grundstücken gibt es Häuser, die R. an die Südstaaten erinnern. Große Veranden laufen um das Häuser herum, die oft erhöht oder auf Pfeilern stehen. Die Straßen sind überflutet. Die Bäche reißend geworden. Vor ihm hält ein Kleinwagen vor einem Bach an, der nun über die Straße fließt. Durch eine Senke. Sie wissen nicht, wie tief das Wasser ist. Warten. Auf der anderen Seite des „Bachs“ hält ein Lieferwagen an. Schaut und wartet. Hinter ihm kommt ein Lastzug an. Schaut und fährt durch. Nun wissen alle, wie tief der Wasser ist. Der Lieferwagen fährt langsam durch. R. auch. Das Wasser geht bis zu den Stiefeln. Das ist OK. R. kommt am anderen Ende an. Zu tief für den Kleinwagen. Er liegt zu tief. Könnte weggespült werden. Bleibt, wo er ist.
In Zugdidi geht R. ins Guesthaus Levan II Dadiani. Gut bewertet. Nicht empfehlenswert. Sehr altmodisch. Die Besitzer sind sehr zurückhaltend. Abend in die trostlose Stadt zum Essen.





















81. Tag; Samstag, 22. Juni 2024; Fahrt nach Mestia; 135km.
R. ist von der Landschaft begeistert. Es geht durch ein liebliches Tal. Die Häuser am Straßenrand erinnern wieder an amerikanische Südstaatenhäuser. Daneben Friedhöfe mit Grabsteinen, die Bilder der Verstorbenen in natürlicher Größe zeigen. Manche haben auch Pavillons aus Glas. Gewächshäuern nicht unähnlich, um die Gräber gebaut. Andere setzen den Grabpavillons Zwiebeltürmchen mit einem Kreuz drauf.
Im Hintergrund tauchen die schneebedeckten Berggipfel des Kaukasus auf.
An einem Wasserfall neben der Straße macht er Langzeitbelichtungen. Ein Bus hält an und Leute steigen lachend aus und posieren vor dem Wasserfall für ein Erinnerungsfoto. R. macht mit. Sie spendieren ihm ein mit Fleisch gefülltes Blätterteigtäschchen, als sie ihr Picnic auspacken. R. fährt weiter. Die Straße wird steiler. Er überholt zwei junge Radfahrer. Sie quälen sich den Berg hoch. R. hält an, die Radfahrer und ein einheimisches Pärchen mit ihrem Auto auch. Sie kommen ins Gespräch. Die Radler kommen aus den USA, wohnen und arbeiten aber in Garmisch. Die ersten swanetischen Dörfer mit ihren charakteristischen Wehrtürmen tauchen auf. Eine Kuh steht davor und schaut R. an. Foto. In Mestia angekommen, gibt es ein Upgrade im Hostel Paliani. Er bekommt ein Zimmer im dazugehörigen Hotel, da das Hostel voll besetzt ist. Im Ort gibt es ein Minikino. Dort wird ein Heimatfilm gezeigt, der in der Zeit direkt nach dem zweiten Weltkrieg spielt („Dede“). Eindrucksvoll! Er erinnert R. an die Fotos von Natela Grigalaschvili, einer bekannten zeitgenössischen Fotografin aus Swanetien. Durch diesen Film werden ihre Bilder lebendig.













82. Tag; Sonntag, 23. Juni 2024; Fahrt nach Ushguli & Zagari-Pass; 75km
Morgens besichtigt R. einen Wehrturm aus dem 10./11. Jahrhundert. Er ist 28m hoch. Die Leitern sind steil, der Ausblick geil. Die Menschen lebten im angrenzenden Gebäude zusammen mit den Tieren in einem riesigen Raum. Die Betten waren über den Tieren. So war es wärmer.
Die Straße ist besser als erwartet. Meist asphaltiert. R. hält immer wieder an, um Bilder zu machen. An einer Stelle hält auch ein Minibus (eine Art private Öffis). R. unterhält sich mit einem Ehepaar und trifft die beiden amerikanischen Radler von gestern wieder. In Ushguli angekommen, fährt R. gleich zum Zagari-Pass weiter. Die Straße wird zu einer steilen Sandpiste, auf der auch LKW verkehren. Staubig. Es gibt ein paar leichte Wasserdurchfahrten. Am Pass dann ein Erinnerungsfoto machen. Umdrehen. Zur Unterkunft. Das Navi ist nicht sehr hilfreich. Er muss suchen, welcher kleine Weg oder Pfad in zum Hostel führt. Dabei geht es auf der Sandpiste steil bergab. Vor ihm eine Gruppe touristischer Reiter. R. muss jetzt rechts in einen holprigen Weg. Die Reitergruppe bleibt aber stehen. R. bremst und will anhalten. Nimmt den rechten Fuß runter. Das Bein ist zu kurz. Ein Loch. Das Motorrad kippt im Zeitlupentempo nach rechts und legt sich hin. Das Ende des Bremshebels bricht an der Sollbruchstelle. Nicht allzu schlimm. Der Hebel ist noch lang genug zum Bremsen. Ein paar Leute haben gesehen, dass R. gestürzt ist. Niemand kommt, um zu helfen. Er muss erst zwei Jugendliche mehrfach Bitten, damit sie ihm helfen. Motorräder sind hier selten. Vielleicht meinen sie, dass Motorräder – ähnlich wie Pferde, die hier jeder von Kindheit an reitet – von selbst aufstehen! Zuerst auf den Parkplatz des Lokals neben der Straße geparkt, um zu sehen, wo die Unterkunft ist. Dann zu Fuß hin und anschließend das Moped nachgeholt. Ein Pärchen auf eine GS Adventure wagt sich den holprig-schlammigen Weg am Hostel vorbei und will zu seiner Unterkunft. Kein Weiterkommen mit dem Brocken. R. hilft dabei, die Kuh zu wenden. In den umliegenden Unterkünften sieht R. einige Motorräder stehen. Manche sind abenteuerliche Wege zu den Häusern gefahren. Respekt.
Beim Gang durch die Gassen bzw. Pfade (für Pferde oder Maultiere geeignet) trifft R. auf ein paar Männer, die eines der verfallenden Gebäude restaurieren. Sie bauen ein Kino, sagt einer der Männer, der eher zuschaut als arbeitet. Es ist der Mann der Regisseurin, die den Film „Dede“ gedreht hat. R. erkennt auch einen der Arbeiter. Er hat die eine der beiden männlichen Hauptrollen gespielt. R. freut sich riesig, sie zu treffen. Die Eltern der Regisseurin führen das Lokal, an dem R. vorhin das Motorrad abgestellt hatte. In den Gassen, dessen Pflaster wohl seit Ewigkeiten nicht mehr erneuert worden ist, kommen im zwei Jungen auf ihren Pferden entgegen. Ein Fohlen folgt ihnen. Pferde scheinen hier das gewöhnliche Fortbewegungsmittel zu sein. Da im Tal mal wieder das Internet ausgefallen ist, muss alles bar bezahlt werden. R. hat nicht mehr viel Bargeld. Sparsam sein. Ushguli ist der Höhepunkt der meisten Reisenden. Manche fahren noch weiter in die schwer zu erreichenden umliegende Dörfer. Das ist ohne Enduroreifen aber nicht möglich. Abends gibt es wieder Internet und damit ein gutes Abendessen.





83. Tag; Montag, 24. Juni 2024; Ushguli-Gletscher
Heute ist Wandertag für R. Zum Gletscher. 10km das Tal hinauf. An einem Bach entlang, vorbei an einem Kieswerk. Hier oben ein Kieswerk. Das brauchen sie wohl für den Straßenbau. Rechts und links des Bachs stehen die Wiesen in voller Blüte. Übersät mit Blumen aller Farben. R. hat so etwas noch nie gesehen. So muss es bei uns auch mal gewesen sein. Bevor alles vernichtet wurde. Auf dem Weg zum Gletscher trifft R. auf das amerikanische Pärchen. Das GS Adventure Paar überholt ihn auf Pferden mit Guide. Es sind recht viele Leute zum Gletscher unterwegs. Einige fahren auf dem Kiesweg. Soweit sie kommen. Bäche kreuzen die Straße. Manche tiefer als andere. Kleine Stege für die Spaziergänger über sie hinweg. Man muss sie nur im Gestrüpp finden. Das Gletscherende ist eher langweilig. Wie meist bei solch eisigen Naturmonumenten. Eine graue Wand, aus der Wasser läuft. Manchmal rutschen ein paar Steine vom Eis hinab. Auf der Muräne ist ein Wegweiser für die Wanderer angebracht. Für die, die noch weiterwollen. Ein Tourist einer polnischen Gruppe hat drei T-Shirts mit seinen Lieblingsfußballern dabei. Lewandowski natürlich auch. Und auch Neuer. Und ein T-Shirt des polnischen Meisters. Drei T-Shirts für eine Wanderung. R. macht ein Gruppenfoto von den Polen.
In der Unterkunft sind nun noch Radler aus den Niederlanden. Ein Mopedfahrer aus der Tschechei, ein Tramper aus Frankreich. Und andere mehr.




84. Tag; Dienstag, 25. Juni 2025; Fahrt nach Anaklia am Schwarzen Meer; 210km.
Es geht die gleiche Strecke zurück. Nach ein paar Kilometern haben Bauarbeiter die Straße aufgerissen. Mit einer Planierraupe schieben sie anscheinend Geröll von einem Erdrutsch den Hang hinunter. Nach ein paar Minuten Wartezeit fährt R. als erster los. Kommt nicht weit. Das Vorderradversinkt in einem Loch und er liegt da. Auf der Straße. Vor Publikum. Ein Straßenarbeiter kommt schnell herbei und mit vereinten Kräften und viel Mühe richten sie die Kuh wieder auf und R. kann weiterfahren. Peinlich. Mal wieder. R. hat wohl verlernt, wie man im Gelände fährt. Die Erfahrung aus den GCC- und IGE-Endurorennen- hätten eigentlich eine Hilfe sein sollen. Vielleicht gibt er nicht genügend Gas.
Das Schwarze Meer. Baden. Oder doch nicht. Vom sehr gepflegten Ressort geht er an den Kiesstrand. Kein Sand. Das Wasser ist trüb und nicht warm genug. Nur für einige wenige scheint es angenehm, die aber auch nicht ganz reingehen. Der Ort sollte mal ein Ferienparadies werden. Unter Schewadnaze. Es wurde viel angefangen, nichts zu Ende geführt. Skurrile Kulisse, wie aus einer anderen Zeit. Der Ort ist den Verfall preisgegeben. Auch, wenn noch der ein oder andere Neubau hochgezogen wird. Neben solchen, die nie fertig wurden. Inter-apokalyptisches Szenario.
Abends im Hotel übt eine größere Gruppe junger Leute einen Volkstanz ein. Der Leiter scheint jedoch zu verzweifeln. Es ist noch bei weitem nicht harmonisch. Die Choreographie noch nicht verinnerlicht.
Abends versucht R. über eine App eine eSIM für die Türkei zu installieren. Er stellt sich etwas ungeschickt an und macht einen Fehler. Damit ist die nicht nutzbar. Tschüß 20$.




85. Tag; Mittwoch, 26. Juni; Fahrt nach Batumi am Schwarzen Meer; 250km.
Das Navi kommt mit den Straßen nicht zurecht. Es ordnet viele Landstraßen Autobahnen zu. Also muss R. nach (Navi-) Karte ohne Zielführung fahren. Geht auch. Nur manchmal irrt er sich und kehr um. Viele kleine Straßen enden abrupt oder werden zu überschwemmten Wegen (es hat wieder geregnet). Nach einem unbeschrankten Bahnübergang verfolgt die Polizei R. mit Blaulicht. Er registriert es erst nicht und wundert sich über den Polizeiwagen im Spiegel. Er fährt rechts ran und einer der Polizisten steigt aus. R. hat das Stoppschild am Bahnübergang missachtet. Strafzettel umgerechnet 30€, einzulösen bei einer Bank. Im nächsten Ort hält er an einer Bank an, um zu bezahlen. Lange Warteschlang. Gegenüber trinkt er etwas, was er in einem schäbigen Laden gekauft hat. Im nächsten Ort geht er zu einer Bank und will zahlen. Kreditkarten werden dafür nicht akzeptiert. Also erst Geld wechseln und dann bezahlen. Nun gut, beim nächsten Stoppschild hält R. an. Wenn Polizei in der Nähe ist. Die Polizei stoppt sehr viele Autofahrer ein bisschen überall, wie R. feststellen muss. Anscheinend warten sie an neuralgischen Punkten. Mit Erfolg.
Den letzten Teil der Etappe bis Batumi nimmt R. eine Autobahn. Eine tiefschwarze Regenwand kommt auf ihn zu. Er hält an und schafft es gerade noch so, sich die Regensachen anzuziehen. Sintflutartige Regenfälle bis kurz vor Batumi. Mit Sturm und Gewitter. In der Stadt hat sich das Wetter beruhigt. Unterkunft Karvi-Hotel in einem historischen Gebäude. Wird von Türken geführt. Schöner Biergarten im Innenhof.
Die Stadt ist eine Mischung von modernen Hochhäusern und Stadtteilen aus dem 19. Jahrhundert. Es wird viel teurer Wohnraum gebaut und gleichzeitig verkommen ältere Gebäude. Etliche Neubauten scheinen leer zu stehen. Zu teuer oder Abschreibungsobjekte der lokalen Mafia (wie jemand sagt)?
Hier leben viele Türken. R. schlendert durch das historische türkische Viertel. Geht in die Moschee und trinkt gegenüber in einem Keller Çay. Daneben der Hafen. Männer sitzen am Kai mit seiner niedrigen schwarz-gelben Mauer und angeln. Ein paar kleine Fische werden gefangen. Daneben eine Art Vergnügungsviertel. Wie ein Jahrmarkt. Mit vielen arabischen Besuchern.



86. Tag; Donnerstag, 27. Juni 2024; Batumi.
Ausschlafen. R. fühlt sich danach erholt. Heute will er die Stadt erkunden. Sie ist quirlig. International. Erst einmal das Altstadtviertel mit seinen türkischen Bewohnern. Die Häuser in diesem Viertel, vermutlich aus dem 19. Jahrhundert, haben meist große Balkone.
In den letzten Jahrzehnten kamen etliche Gebäude hinzu. Das war ein Hobby des damaligen Präsidenten. Er sitzt jetzt wegen Korruption im Knast. Da es eine wichtige Hafenstadt ist, finden man Menschen aus allen Regionen und Kulturen: Georgier, Türken, Juden, Christen, usw. Die Stadt boomt, nicht zuletzt wegen Putins Politik. Viele Russen sind hierher ins Exil gegangen oder arbeiten als digitale Nomaden. Das treibt den Bauboom an. R. hat Zweifel, ob so viele, so teure Wohnungen gebraucht werden. Einheimische können sie sich meist nicht leisten. Die Mieten übersteigen das Monatsdurchschnittseinkommen eines Georgiers um ein Vielfaches.
Im Hostel sind unter anderem zwei Studentinnen aus der Slowakei und Slowenien, die hier aus Kostengründen studieren. Sie wohnen während des Studiums im Hostel. Keine Privatsphäre.
In der Nacht schaut R. sich das Treiben auf der Vergnügungsmeile am Hafen an. Viele arabische Familien scheinen hier Urlaub zu machen und nutzen die Freiheit, die ihnen Georgien bietet.




87. Tag; Freitag, 28. Juni; Fahrt nach Uzungöl (Türkei); 200km.
Uzungöl? Weil das eine Iranierin im Hostel R. empfohlen hat. Dort gibt es laut Navi auch einen Campingplatz. Also zelten. Der Platz stellt sich als Lagerplatz für Baumaschinen heraus, auf dem ein paar alte, dem Verfall preisgegebene Hütten stehen, in denen aber Leute übernachten oder gar wohnen (der Besitzer). Daneben stehen Wohncontainer für Arbeiter. Es gibt eine Gemeinschaftstoilette zum Abgewöhnen. Waschen: mehrere Wasserhähne draußen an einer Wand angebracht. Natürlich kalt. Es kommt abends noch ein Auto mit zwei Männern (Arzt, Polizist) und ihren Söhnen. Sie bauen ein großes Zelt auf und gehen dann essen.
Der Zeltplatz steht im krassen Widerspruch zu den Touristen, die aus dem arabischen Raum kommen und hier am gleichnamigen See Zeit verbringen: mit dem dicken Auto herumfahren und alles aus dem Fenster filmen, was vor die Linse kommt (v.a. Bäume). Es gibt einen kleinen Vergnügungspark für die Familien. Das ist für R. alles völlig unerwartet und passt hier nicht her. Anscheinend gibt es in der Nähe einen Flughafen, über den die Saudis und Kuwaitis anreisen. Ansonsten hat der Ort nur eine schöne Landschaft zu bieten.
88. Tag; Samstag, 29. Juni 2024; Fahrt nach Maçka; 190km.
Morgens steht R. früh auf und macht sich einen Kaffee auf einem der maroden Tische auf dem Zeltplatz. Anschließend fährt er die Bergstraßen nach Maçka. Zuerst hat die Straße noch ein gut gepflegtes Kopfsteinpflaster. Das Tal wird enger. Atemberaubend schön. Überall am Straßenrand wird Essen und Trinken angeboten. Teppichhändler breiten ihre Waren auf den Zaunstangen zwischen Straße und Bach aus. Es geht weiter hoch. Das Kopfsteinpflaster endet. Beton kommt. Die Bäume verschwinden. Richtige Zeltstädte breiten sich rechts und links der Straße aus. Es sind Picnic-Zelte. Weiß, manchmal bunt. Ein paar Bauerhöfe und die ein oder andere Siedlung. Sie Straße ist jetzt einspurig. R. und ein einheimisches Auto halten bei einer Schafherde neben einem Bauernhof an und fotografieren die Schafe. Auch die tote Kuh, die daneben liegt. Es geht steil bergauf. Aus Beton wird Schotter. R. fängt an zu frieren und zieht seine Regenkombi an. 5°C; R. ist in den Wolken. Das Navi zeigt 3.000m Höhe an. Rechts und links des Weges liegt noch meterhoch der Schnee. Die Piste wird schlechter. Wo soll das enden, denkt sich R.? Es geht weiter; nur ein Tiguan aus Deutschland kommt ihm in Schritttempo entgegen und umfährt sorgsam alle großen Schlaglöcher. Die Haarnadelkurven der Serpentinen sind durch Regen stark erodiert. R. muss manchmal in der Kurve anhalten, um in die richtige Spur zu kommen und nicht auf dem losen Geröll zu fahren. Alles geht nur im 1. Und 2. Gang. Dann geht es endlich bergab. Aber auch nur im 1. und 2. Gang. Es ist steil. Vorsichtig bremsen. Motobremse nutzen. Vor ihm fährt ein Bimobil Allrad-Womo aus Spanien. Sie lassen R. passieren. Falls er anschließend irgendwo stürzen sollte, wäre zumindest Hilfe da, denkt R. sich. Endlich ein Ortsschild. Bayburt. Er checkt das Navi. Alles gut. Er ist richtig. Der Schotterweg wird zu einer schmalen Asphaltstraße. Die Temperaturen steigen. Angenehm für R. Das Tal wird breiter; schmale Weizenfelder breiten sich aus. Nur wenige Bäume. Es ist geschafft. Später erfährt R. von „Völki“ (in Ushguli mit seiner GS Adventure und seiner Frau getroffen), dass er sie berühmt-berüchtigte D915 gefahren ist. R. denkt sich, dass es gut ist, dass er es vorher nicht wusste. Er wäre sonst die Hauptstraße über Trapzon gefahren.
Im Nachhinein überprüft R. noch mal seine Route und stellt fest, dass er eine Parallelstraße zur D915 gefahren ist. Sie ist noch anspruchsvoller als die D915…
In Bayburt Tee getrunken und mit Gästen unterhalten. Der Sohn eines Gastes, der in der Schule Deutsch lernt, durfte auf dem Motorrad sitzen. Foto. Da R. sein Handtuch in Batumi vergessen hat, kauft er sich hier ein neues.
Anschließend soll es weiter auf kleinen Bergstraßen gehen. Die Straßen passen nicht zu den Angaben auf dem Navi. Auch die grobe Landkarte hilft nicht. In Yayladere, einem kleinen Ort, wird R. von einem Mann auf Deutsch angesprochen, als er die Karte studiert. Er lädt ihn zu einem Kaffee ein und sie unterhalten sich. Seine Frau, auch Türkin, ist in Deutschland geboren. Der Mann ist als achtjähriger Junge nach Deutschland gekommen. Vor ein paar Jahren sind sie dann in die Türkei gezogen. Sehr nette Leute.
R. fährt weiter über die engen Bergstraßen. Leider ist ihm nicht klar, wo er langfahren muss. In einem Bergdorf mit extrem steilen Wegen steht er mit einem Mal am Ende eines steilen Feldweges, der ins Nirgendwo zu führen scheint. Männer in der Ferne geben ihm zu verstehen, dass er weiterfahren soll. R. kehrt jedoch um und sucht einen besseren Weg. Er nimmt einen zweistündigen Umweg in Kauf und fährt Richtung Küste, um schließlich in Maçka anzukommen. Dort steuert er einen Campingplatz an, auf dem er zuerst alleine ist. Der Platz hat auch ein Restaurant. Er baut das Zelt auf und fährt dann in die Stadt, um sich umzusehen. Çay trinken und Kleinigkeiten zu Essen einkaufen. Als R. wieder auf dem Platz ist, sind zwei Cottbusser mit einem UAZ Buchanka (keine Postkutscher…). Sieht aus, wie ein Nachkriegskleinbus. Ist aber neu. Ausgebaut zum Camper-Van. Ältere Varianten naht R. in Armenien häufiger gesehen.
Abends isst R. im Restaurant des Campingplatzes. Es gibt nur drei Gerichte. Er entscheidet sich für eine gebratene Forelle. Sie schwimmt noch auf dem Teller. In Butter.
89. Tag; Sonntag, 30. Juni 2024; Maçka.
R. besichtigt vormittags das Marien-Felsenkloster Sumela. Von den Osmanen geduldet und gefördert, da sie auch Marien huldigen. Nachdem vor etwa 100 Jahren das Kloster abbrannte, haben die Mönche es verlassen. Jetzt ist es wieder aufgebaut worden und man zahlt 20€ Eintritt (als Ausländer).
Anschließend fährt er zum Mittagessen nach Maçka. Beim Çay spricht R. mit anderen, türkischen Gästen, die in Deutschland leben. Sie sind zu Besuch hier.
Mit den Cottbussern redet R. noch über Van-Life und was Allrad und Differentialsperre an einem Fahrzeug bringen. Trotz dieser Systeme sind sie schon einmal einen schlammigen Weg bergab gerutscht und hatten dabei ziemlich Angst.
90. Tag; Montag, 1. Juli 2024; Fahrt nach Amasya; 500km.
Amasya ist eine wunderschöne, restaurierte Stadt an einem Fluss. Dort kommt R. nach einer langen Fahrt an. Erschöpft. Etwas spazieren gehen. An der Flusspromenade. Dort ist viel los. Die Leute flanieren hier und freuen sich des Lebens. Es werden Folklore-Tänze und Gesang gezeigt.



91. Tag; Dienstag, 2. Juli 2024; Fahrt nach Sinop; 260km.
Vormittag geht R. noch einmal durch die Altstadt mit ihren Geschäften auf der anderen Flussseite. In der großen Moschee steht ein Brautpaar, dass R. auch gleich fotografiert. Sie geben ihm ihre Kontaktdaten. Leider hat er etwas falsch notiert und kann ihnen das Bild nicht schicken. Schade.
Anschließend an den Strand von Sinop, einer sehr lebhaften Küstenstadt. Der städtische Camping- und Picnic-Platz ist eine einzige Katastrophe. Überall Müll, keine ebenen Flächen, kein Strom, Duschen auf der anderen Straßenseite im Strandbad, Toilettencontainer vor dem Platz. Ein paar Leute campen hier. Auch ein junges türkisches Studentenpärchen. Nahe R.s Zelt. Nachts leben sie ihre Zuneigung geräuschvoll aus.
R.s Matratze lässt die Luft raus. Hat wohl ein kleines Loch. Bei diesem Müllplatz kein Wunder. Überall Scherben etc.! Er findet keinen Schlaf. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als in die Nacht zu lauschen.
92. Tag; Dienstag, 2. Juli 2024; Fahrt nach Amasra; 320km.
Morgens geht R. über die Straße zur „Badeanstalt“. Einige ältere Herren sind bereits anwesend und haben ihr Bad im Meer genommen. Das Wasser hier ist klar. R. geht zögerlich hinein. Er mag warmes Wasser. Sehr warmes Wasser. Dann schwimmt er ein bisschen und geht wieder raus. Duscht. Geht zum Zelt. Packt seine Sachen. Macht sich Frühstück und fährt los.
Am Meer entlang. Eine vierspurige Schnellstraße begleitet das Ufer fast am gesamten Schwarzen Meer und schneidet den Strand von den Ortschaften ab. Dadurch wirkt das Meer unnahbar. Zudem gibt es keinen Sandstrand, sondern mehr oder weniger große Kieselsteine oder Felsen. Oft ist das Wasser trüb und lädt nicht zum Baden ein. Die Orte selbst sind in einem starken Wandel begriffen. Es wird sehr viel neu gebaut. Es fehlt an Harmonie. An Charme. Die Küste ist nicht attraktiv.
Amasra ist anders; eine kleine Hafenstadt mit Charme und Weltkulturerbestempel (wofür?). Angenehm für einen Tagesausflug. Netter Stadtstrand mit Liegen, für die man 400 TL zahlen muss.
R. hat ein schickes, kleines Hotel direkt fast direkt am Wasser. Die Straße dorthin ist eigentlich gepflastert. Wenn die Steine noch da liegen würden, wo sie einst hingelegt wurden.
93. Tag; Mittwoch, 3. Juli 2024; Fahrt nach Akçakoça; 280 km.
Der erste Halt ist Safranbolu. Auch Weltkulturerbe und gut erhalten. Eine Stat im osmanischen Stil. Restauriert und bei Touristen beliebt.
Die Fahrt führt in zum Teil durch schöne Landschaften, vor allem zwischen Devrek und Alapli. Der Zustand der Landstraßen wechselt von gut bis miserabel.
In Akçakoça günstiges Hotel (Konaç Hotel). Ist aber in Ordnung. Auf der Ufrpromenade vor dem Hotel sind die berühmtesten Herrscher des Osmanischen Reichs bis hin zur Gründung der Türkei als Büsten dargestellt. Es hört bei Atatürk auf. Gut s. R. fotografiert dort eine Familie mit ihrem zwei kleinen Jungen. Danach sucht er einen Friseur. Es ist mal wieder notwendig. Er ist nicht allein im Frisörsalon. Ein türkischer Matrose hilft bei der Verständigung mit dem Barbier. Im Fernseher laufen Bilder von Bursa, das gerade in den Regenfluten untergeht. Das wäre R.s. Ziel für morgen gewesen. Er wird umdisponieren müssen. Istanbul anstatt Bursa. Schade.
Auf dem Rückweg besichtigt R. noch die sehr moderne Moschee. Ganz anders, als die bisherigen. Gewagt.
Abends wird die Stadt von einem schweren Gewitter heimgesucht. Der Strom fällt für längere Zeit aus. R. wartet, bis der Strom wieder da ist, um ein Restaurant für das Abendessen zu finden.
94. Tag; Donnerstag, 5. Juli 2024; Fahrt nach Istanbul; 270km.
R. fährt nach Istanbul. Keine Autobahn, da er sich dafür nicht registriert hat. Also gemütlich die Küste und dem nahen Hinterland entlang. Hinter Akçakoça gibt es auch Strände. Schwarze Strände.
Die Strecke ist sehr schön. Buchen- und Eichenwälder. Auch die Türkei war mal komplett bewaldet. Viel ist davon nicht übrig. In den Wäldern sieht R. Köhler und fotografiert sie bei ihren qualmenden Meilern. So etwas hat er bisher nur gelesen, nie gesehen. Er fährt auch an zahlreichen Haselnussstrauchplantagen entlang. Ob die auch Ferrero gehören, wie die, die er schon früher gesehen hat?
Je weiter er nach Istanbul kommt, desto dichter wird die Besiedlung. Ist zu erwarten. Dann 40km Stadtverkehr! Mit der Fähre geht es über den Bosporus, um keine Vignette kaufen zu müssen.
R. hat ein Zimmer im Hotel „Chambre de la Bohème“ nahe dem Taksim-Platz. Das Moped stellt er vor der Tür ab und geht nach dem Einchecken spazieren. Hier ist mehr Gedränge als in Venedig!


95. Tag; Freitag, 6. Juli 2024; Istanbul.
R. ist etwas von der Stadt genervt. Zu viele Leute und die Luft ist bei ihm raus. Er braucht Ruhe. Bursa wäre besser gewesen. Um den Tag zu verlangsamen, bucht er eine Bosporus-Fahrt, die er schon 2020 gemacht hat. Mit seiner Frau damals. Den ganzen Tag auf einem Schiff und in einer kleinen Hafenstadt, Anadolu Kavağu. Nichts Aufregendes. War mal ein wichtiger Ort. Irgendwann in der Geschichte.
Danach ist ein Stadtrundgang mit Guru Walks angesagt. Aber irgendwie findet R. den Ort nicht. Hat auch keine Internetverbindung. iPhone macht Probleme. Keine Kommunikation möglich.
Am Abend dann wieder Fußball-WM. Die Türkei verliert und fliegt raus. Wie Deutschland am Vortag auch schon. Es bleibt ruhig in der Stadt. Im Lokal mit der Fußballübertragung lernt R. Leo aus Russland kennen. Er arbeitet in Istanbul für eine NGO, die Hilfe für die Ukraine organisiert. Seine Frau und sein Kind sind auch in der Stadt. Er hat schon zweimal versucht, eine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland zu erhalten. Dem Studierten Russen wurde das verweigert. Solche Leute braucht Deutschland!
Der Hostelwirt sagt R., dass der Nachbar es nicht gut findet, dass er sein Moped vor seiner Haustür parkt. R. soll am nächsten Morgen möglichst unbemerkt verschwinden. Der Nachbar könnte sonst schnell die Polizei benachrichtigen und dann gäbe es Ärger. Nach seiner Meinung ist die Polizei in diesem Fällen gerne bereit, zu handeln, da sie davon profitieren würde. Nun ja, R. wird vorsichtig sein.








96. Tag; Samstag, 7. Juli 2024; Fahrt nach Edirne; 270km.
Morgens schleicht sich R. mit dem Moped ohne Motor davon, damit der Nachbar ihn nicht bemerkt. Der Wirt hat ihn ja vorgewarnt.
Die Fahrt führt durch große Eichenwälder, abgeerntete Weizen- und endlose Sonnenblumenfelder.
Edirne selbst findet R. ganz nett. Die Stadt war eine Zeitlang die Hauptstadt des osmanischen Reichs. Eine Mischung verschiedener Architekturstile: verfallende osmanische Gebäude und daneben solche aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert.
Er wohnt in ehemaligen jüdischen Viertel der Stadt, dass Anfang des 20. Jahrhunderts abbrannte und dann neu gebaut wurde. Die ehemals 13 kleineren Synagogen wurden nicht wieder aufgebaut, dafür eine große. Die zweitgrößte Europas. Sie wurde vor kurzem restauriert, da sie baufällig geworden war.
R. schlendert noch ein wenig durch die Stadt. Geht in den Basar, der in einem historischen Gebäude. Dort werden Unmengen an Kitsch verkauft. In einer riesigen, alten Karawanserei befindet sich das beste Hotel des Orts. Im Innenhof trinkt R. einen Kaffee.
Abends sucht sich R. ein Restaurant. Man sitzt draußen. Es ist mild. Vor einem Lokal spielt eine Musikgruppe türkische Folklore. Er setzt sich dorthin und hört zu. Macht Bilder. Schickt es einem der Musiker über WhatsApp.
97. Tag; Sonntag, 8. Juli 2024; Edirne.
R. informiert sich über die Stadt. Sie hatte in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts über 200.000 Einwohner. War wichtig. Nach den Balkankriegen und der kleinasiatischen Katastrophe (70.000 Griechen mussten die Stadt verlassen), sank die Einwohnerzahl auf nur noch 30.000. Das Leben kam praktisch zum Erliegen. Erst nach dem zweiten Weltkrieg erholte sich die Stadt von dem Aderlass. Heute ist sie wieder lebendig.
Bekannt ist Edirne für die Bauten des berühmten türkischen Baumeisters Sinan, der mächtige Moscheen errichtet hat. So will R. die einzigartige Suleyman-Moschee besichtigen. Sie ist jedoch leider wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Nur ein Gebetsraum ist für Gläubige offen. So besichtigt R. die anderen Moscheen und den Beyazit II Komplex (erbaut von Sultan Beyazit II im 15. Jhd.), bestehend aus einer Moschee, einer Medrese (Lehranstalt; hier medizinisch) und einem Spital (Darüşşifa). Letzteres ist eine Art frühe Wohltätigkeitsstiftung des osmanischen Reichs. Reiche Leute bauten solche Anlagen, um armen Menschen zu helfen. Dafür gründeten sie Stiftungen, die es zudem ermöglichten, das Vermögen beisammenzuhalten und ohne Splittung an die folgenden Generationen weiterzugeben.
Vor der Stadt gibt es ein Militärmuseum zu den Balkankriegen. Dort werden die Taten des osmanischen Reichs (etwas zu sehr) verherrlicht. Eigentlich hat das dem Untergang geweihte Osmanische Reiche den Angreifern aus Bulgarien und Russland nicht viel entgegenzusetzen gehabt. Die Soldaten und die Bevölkerung haben tapfer gekämpft. Erfolglos. Das Museum ist eher ein Propagandamittel der türkischen Regierung.






98. Tag; Montag, 9. Juli 2024; Fahrt nach Sofia (Bulgarien); 350km.
Es geht von Edirne über die nahe griechische Grenze direkt zur bulgarischen. Obwohl EU und Schengen (seit März 2024), gibt es strenge Grenzkotrollen nach Bulgarien hinein. Die Fahrt führt R. durch weite Täler mit Landwirtschaft. Obwohl es in Bulgarien für Motorräder keine Autobahnmaut gibt, fährt er auf Landstraßen nach Sofia. Meist parallel zur Autobahn. So kann er die Ortschaften sehen. Wie die Leute leben. Die Häuser sind kleiner als in der Türkei, aber gepflegter. Die letzten Kilometer führen in um einen großen, langgezogenen, malerischen See. Das Iskar Wasserreservoir. Ein Wunderschönes Erholungsgebiet.
Hotel in Sofia. Ohne Klimatisierung. Es ist heiß und stickig. Unerträglich heiß.
Die Stadt hat noch recht viel Bausubstanz aus dem 19. Jahrhundert. Viele kleine Geschäfte. Marode Bauten mit viel Graffiti. Erinnert R. an Berlin nach vor 10-20 Jahren.
Frankreich hat in der WM gegen Spanien verloren.
99. Tag; Dienstag, 10. Juli; Sofia.
Zielloser Stadtspaziergang. Dann geführter Rundgang mit Guru-Walks. Nachmittags schläft R. etwas, bevor er sich etwas unschlüssig mit dem Fotoapparat aufmacht. Hitze. Vor R. Hostel rattert laut eine Straßenbahn in Orange vorbei. R. geht zufallsverteilt die Straßen entlang. An einem riesigen historischen Gebäude wird ein Model fotografiert. Auch von R.
Der Prunk von einst ist noch überall gegenwärtig. Auch wenn der Putz bröckelt.
In Sofia kann R. von einem Jahrtausend ins nächste, von einer Kultur zur anderen gehen. Alles liegt beisammen. Römer, Byzantiner, Europas größte Synagoge, katholische und orthodoxe Kirchen, die Banja-Bashi Moschee (einzige noch aktive). R. findet, dass die Synagoge von innen eher einer Kirche denn einer Synagoge gleicht. Unter Boris III konnten 50.000 Juden vor der Deportation während des 2. WK bewahrt werden. Verzögerungstaktik. Nach dem Krieg sind die meisten von ihnen nach Israel ausgewandert.
An der Kathedrale findet ein riesiges Samsung Event statt. Nur für geladene Gäste. Alle anderen stehen vor dem Zaun und betrachten das Spektakel. Ein in Bulgarien bekannter Violinist spielt wie André Rieu.
Die Niederlande verlieren gegen England in der Fußball-WM.





Tag 100!; Mittwoch, 11. Juli 2024; Fahrt nach Niš (Serbien). 310km.
Es geht für R. aus Richtung Südwesten kommend durch die Berge. Vorbei an Tran. Die Gegend ist ruhig. Und schön. Es ist heiß. Die Wege werden schmaler. R. hat sich eine alternative Route ausgesucht, um mehr von der Gegend zu sehen. Die Wege werden zu Schotterpisten. Enden in Wiesen und Wäldern. Mehrmals dreht er um und sucht bessere Wege. Die Navi-Karte ist nicht ganz auf der Höhe der aktuellen Straßenbedingungen. R. hat „keine unbefestigten Straßen“ eingegeben. Funktioniert nicht immer.
In Niš hat R. ein Zimmer in einer neu renovierten Wohnung. Sehr schön. Alles läuft online. Auch die Kommunikation. Zwischendurch taucht eine elegante, ältere Dame mit Hund in der Wohnung auf. Sie spricht nur ihre Sprache. Es ist die Wirtin. Sie macht etwas und geht wieder. Wortlos.
Die Stadt ist größtenteils ein Produkt der Nachkriegsarchitektur. Sowjetstil. Einige alte Gebäude aus verschiedenen Epochen der Stadtgeschichte sind noch sichtbar: römisch, byzantinisch, osmanisch. Die riesige Burganlage ist 22ha groß! Heute mehr Park als Festung.
R. macht keine Fotos. Geht nur in der Stadt spazieren.
Tag 101; Donnerstag, 12. Juli 2024; Fahrt nach Pribojska Banja; 300km.
Die Fahrt führt R. durch den Süden Serbiens. Bewaldetes Mittelgebirge. Wie der Böhmerwald. Die Temperaturen steigen auf bis zu 38°C. R. parkt das Motorrad bei einer Pause unter einer Trauerweide, deren Äste bis auf den Boden reichen. Sonnenschutz. Die Gehöfte sehen alt aus. Sind alt. Auf den Wiesen ist Heu in großen Haufen gestapelt. Aus der Mitte schaut eine große Stanger heraus. Wie ein riesiger Schaschlik Spieß. R. fährt ohne Halstuch und mit offener Jacke. Jetzt passiert es doch. Musste ja passieren. Ein Stich in die Brust. Eine Wespe hat den Weg in das T-Shirt gefunden und zugestochen. R. hält an. Steigt ab. Zieht die Jacke aus und schüttelt die Wespe aus dem Shirt. Aufsteigen und Weiterfahren. Mit offener Jacke und ohne Halstuch.
Pribojska Banja ist ein Bad, wie der Name schon sagt. Hier kommt warmes Wasser aus dem Boden. Die Badeanstalt nicht weit von R. Zimmer nutzt es. R. auch. Auf dem benachbarten Gelände eines Hotels und einer Kirche fließt ein Rinnsal in einer Art Kanal. Warmes Wasser. Er lässt seine Beine darin baumeln. Eine Gruppe Frauen kommt dazu und sie baden ihre Füße in dem schnell fließenden Wasser. Sie sitzen nicht weit auseinander und R. holt die Kamera raus, während eine der „Badenden“ ihm zulächelt. Sie bekommt auch „ihr“ Bild. Freut sich. Die Freundinnen lachen gemeinsam.
In der Kirche auf dem Grundstück findet gerade ein orthodoxer Gottesdienst statt. R. geht vorsichtig hinein und macht ein paar Fotos.
Tag 102; Freitag, 13. Juli 2024; Fahrt nach Mostar (BiH). Wanderschuhe abholen; 260km.
Kurz nach der Abfahrt kommt schon die Grenze. Die Abwicklung geht schnell. Es geht weiter Richtung Süden, an der schönen Driva entlang. Nahe der montenegrinischen Grenze ist die Landschaft atemberaubend. Wild. Zerklüftet. Fast, wie Ardèche und Dolomiten zusammen. Trotzdem entspannend. Nach Mostar geht es raus aus dem Gebirge. Immer bergab. Die Temperatur steigt auf bis zu 40°C. Direkt zu Miran, „meinem“ Wirt von der Hinfahrt in Mostar. Er hat aber kein Bett mehr frei; hat mir aber gegenüber im Hostel „David“ ein Zimmer reserviert. Dankend nimmt R. seine vergessenen Wanderschuhe von Mirans Frau in Empfang. Davids Parkplatz ist tiefer Kies. Gas geben, Reinfahren, mit dem Vorderrad versinken und abstellen. Nicht mehr bewegen, sonst fällt sie um. Platte unter den Ständer legen. Morgen wird R. David um Hilfe bitten müssen, um das Motorrad wieder aus dem Kiesbett zu befreien. Die Zimmer im Hostel sind klimatisiert. Angenehmer als bei Miran. Mit im Hostel sind drei Dänen. Die beiden Frauen hatten einen großen Wikinger, der sie wohl gegen alles und jeden beschützt. Falls notwendig. Ein junger Kroate, permanent betrunken, ist gottseidank in einem anderen Zimmer. Mit den DänInnen. Er fordert alle zum Mittrinken aus. R. lehnt ab. Die Dänen erst nach einigen Drinks.
Nachdem er sich eingerichtet hat, geht R. in die Stadt und kauft für das Abendessen und das Frühstück ein. Es ist sein dritter oder vierter Besuch in Mostar. Kennt sich mittlerweile aus. Macht Fotos von Graffitis. Vor allem Graffitis des lokalen Fußballklubs, der 1981 die Meisterschaft gewonnen hat. Seitdem nennen sich die Fans „RA - Red Army“. Das zweite wichtige Datum ist 1986. Da haben sie gegen Belgrad die Meisterschaft gewonnen. Dieses Datum ist nun ein Zeichen zur Abgrenzung gegenüber Serbien und den Serben. In Mostar leben sowohl muslimische Bosniaken als auch orthodoxe Serben. Der Konflikt führte bekanntermaßen zur Zerstörung der antiken Brücke.

Tag 103; Samstag, 14. Juli 2024; Fahrt nach Loznica (Serbien); 300km.
Ein schöner Tag. Eine abwechslungsreiche, fantastische Landschaft zieht an R. vorüber. Zweites Frühstück direkt am Fluss in einem Café.
Malheur an der serbischen Grenze. R. findet seinen Reisepass nicht! Nicht in der Jackeninnentasche, wo er normalerweise wasserdicht in einem Beutel verstaut ist. Nicht im Tankrucksack. Nicht zu finden. Grenzübertritt also mit Personalausweis. In einem trostlosen Hotel in Loznica angekommen, telefoniert R. mit der Botschaft in Belgrad, was zu tun ist. Es ist Samstag. Nur Notdienst in der Botschaft. Soll Verlustmeldung bei der Polizei machen. R. versucht den Grenzposten vom Vortag zu erreichen. Jemand hebt ab und legt nach R.s erstem Satz auf! R. schreibt eine Email mit der Bitte, nachzusehen, ob ein Pass gefunden wurde. Warten. Ruft im Café vom Morgen an. Kein Pass gefunden.
R. braucht den Pass für die Reise mit seiner Frau in die Mongolei. In zwei Wochen. Panik. Er wird einen vorläufigen Reisepass brauchen. Muss ihn sofort nach Ankunft zu Hause beantragen. Urgent. Ohne Umwege zurück nach Deutschland.
R. geht heute nur ein wenig in der Umgebung spazieren. Nicht in die Innenstadt. Alles wirkt etwas trostlos.
Abendessen im Hotel. Nicht wirklich gut. Kein guter Tag.
104. Tag; Sonntag, 15. Juli 2024; Fahrt nach Novi Sad; 125km.
Frühstücken. Motorrad packen. Geldreserve aus dem linken Koffer holen. In dem Beutel liegt der Reisepass! Wie konnte er dort hinkommen? Da war er noch nie. R. wird senil. Ist aber überglücklich.
Also die geplante Tour weiterfahren. Vorbei an kleinen Dörfern und vielen Bauernhöfen, vor deren Einfahrten Gestelle mit getrocknetem und in Zöpfe geflochtenen Knoblauch stehen.
Ziel ist eigentlich Subotica. R. entscheidet sich aber für Novi Sad, während er dort eine längere Mittagspause macht. Das Hostel „Sova“ in einem Altbau wird von Mutter und Tochter geleitet. Die ältere Dame ist fast permanent anwesend. Sie läuft rum, als wäre sie zu Hause. Etwas gleichgültig angezogen, ohne BH wabern ihre riesigen Brüste der kleinen Frau über den großen Bauch. Immer etwas mürrisch und tonangebend. Die Tochter, ca. 50 Jahre alt, ist hingegen schick gekleidet und hyperaktiv. Permanent macht sie etwas und ist dann wieder weg.
Die Stadt ist schön. Eine Mischung alter Gebäude in Verbindung mit bauhaus-ähnlicher Stalin-Architektur. Immer wieder sieht man große Plakate mit politischer Werbung. Gerne zeigen sich die Politiker darauf mit Putin. Man sieht, wohin das Land sich orientiert. Nachdem Serbien in den Balkankriegen nach dem Mauerfall bei den meisten westlichen Ländern aufgrund der Kriegsverbrechen in Ungnade gefallen ist, wendet man sich halt anderen Autokraten/Diktatoren zu. Man sucht seinesgleichen. Macht eine EU-Kandidatur da Sinn? Wohl eher nicht.
In der Stadt fand in den letzten Tagen das „Exit“-Musikfestival statt. Rund 1.000 Künstler traten auf 40 Bühnen aus. Ein Hostelgast erzählt R. davon. Zusammen mit einem Freund muss sich dieser noch davon erholen, bevor er wieder fährt.
R. entdeckt die Stadt. Jung, dynamisch, sauber, interessant. Am halboffenen Markt mit seinen teilweise überdachten Ständen hängen Kleiderbügel an der Dachkonstruktion. Stühle stehen auf den steinernen Auslagen oder sind unter dem Dach in luftiger Höhe festgeklemmt. Auf dem Boden liegt noch etwas Obst und Gemüse, das nicht verkauft wurde. Ein alter Mann geht durch die Reihen und nimmt mit, was noch genießbar ist. Katzen streunen herum.
In den Hinterhöfen der gepflegten Straßen setzt R. sich in Cafés. Trinkt etwas in der Hitze. Auf dem Hauptplatz steht ein alter LKW mit einem großen Tank voll Wasser. Zum Trinken und zur Abkühlung.
105. Tag; Montag, 16. Juli 2024; Fahrt nach Györ (Ungarn); 380km.
Die Fahrt ist lang. Langweilig. Eintönige Landschaft mit Feldern und Weiden. R. vergleicht die Baustile der verschiedenen Gegenden. In Serbien keine Zäune, kleine, alte, quadratische Häuser, die eine überdachte, von Säulen getragene, teilweise umläufige Veranda haben. In Ungarn Zäune. Langgezogene Straßendörfer mit einer langgezogenen Insel in der Mitte. Dort ist die Kirche. Neben den kleinen und alten Häusern werden neue, wesentlich größere gebaut.
Györ selbst ist nach R.s Vermutung ein wichtiger Bischofssitz. Die Stadt ist – ähnlich wie Eichstätt – von Kirchenbauten geprägt. Groß. Schön. Reich. Anscheinend gibt es hier viele deutschsprachige Bürger. Auf einem Schild, einem Wappen nicht unähnlich, steht: „Deutsche Selbstverwaltung der Komitatsstadt Raab“. Raab ist der deutsche Name für Györ.
R. wohnt in einem Gästehaus der Kirche. Alles neu, gepflegt, sauber, schön.
In der Kirche findet ein Gottesdienst statt. Die Kirche ist voll. Alle Plätze besetzt. Am Montag. Es muss ein besonderer Anlass sein. R. weiß nicht, welcher.
106. Tag; Dienstag, 17. Juli; Fahrt nach Büchenbach. Zu Hause.; 620km.
Zügige Fahrt über die Autobahn nach Hause. Es ist jetzt deutlich kühler. Alles läuft gut. Nichts zu berichten.
Nach drei Monaten und zwei Wochen und 17.700 km durch 15 Länder wieder zu Hause. Motorrad hat wunderbar durchgehalten.
R. ist glücklich und etwas erschöpft nach der langen Fahrt.
Der Empfang zu Hause ist herzlich. Seine Frau ist überglücklich, dass R. wieder da ist. R. auch.
EPILOG
Überwältigend. Das ist mein erster Eindruck. Je länger ich an diesem Reisebericht gearbeitet habe, je mehr Abstand ich auch dazu gewonnen habe, desto außergewöhnlicher erscheint mit mein „Abenteuer“!
Mein ursprüngliches Ziel, mit den Menschen über die Verbindung von morgen- und abendländischer Kultur zu sprechen, ist an Sprachbarrieren gescheitert. Nur selten hatte ich die Gelegenheit dazu. Auf der anderen Seite habe ich viel über die Menschen und ihre Kulturen in den vielen Ländern erfahren. Diese Erfahrungen waren sehr unterschiedlich: von Kriegstraumata im ehemaligen Jugoslawien hin zur Warmherzigkeit und Gastfreundschaft in der Türkei, gefolgt von eher distanzierten Begegnungen in Armenien und Georgien. Was der Grund für diese Unterschiede sein könnte, ist mir nicht klar geworden.
Fast all die Länder, die ich bereist habe, haben eine problematische Vergangenheit (und teilweise auch noch Gegenwart), was das Zusammenleben der unterschiedlichen Ethnien oder Kulturen anbelangt: Katholiken/Orthodoxe/Muslime/Juden waren teilweise jahrhundertelang friedlich miteinander umgegangen und zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte fingen sie an, sich die Köpfe einzuschlagen. Die schwächte – und damit am meisten geschundenste von ihnen war sicherlich die jüdische Gemeinschaft. Einst im osmanischen Reich nach dem Zerfall des andalusischen Kalifats willkommen, wurde ihnen spätestens während des zweiten Weltkriegs der Garaus gemacht.
Mit dem Ende des Osmanischen Reichs, das vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts dauerte, bildeten sich neue Nationen, die darauf bedacht waren, eine eigene Identität aufzubauen. Besonders haben darunter die Armenier und verschiedene andere christliche Gruppen in der heutigen Türkei gelitten (hier hat die Türkei auch heute noch einen „blinden Fleck“). Auch die schlechte Beziehung zwischen Griechen und Türken hat ihren Ursprung in den kriegerischen Unruhen der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts („kleinasiatische Katastrophe“). Die Nachwehen sind heute noch zu spüren.
Nach dem Zusammenbruch des Sowjet-Imperiums in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts lösten sich die Teilrepubliken Jugoslawien von den serbisch dominierten Zentralmacht. Serbien ertrug diesen Machtverlust nicht und ging kriegerisch gegen die Separatisten vor, bis hin zu schrecklichen Kriegsverbrechen. Diese Wunden klaffen immer noch und sind in Gesprächen mit den betroffenen Menschen spürbar.
Als ich dann nach Armenien kam, fühlte ich mich in die Sowjetzeit zurückversetzt („Sowjetistan“). Relikte dieser Zeit sind überall zu finden. Das armenische Volk ist von der Geschichte gebeutelt und hat auch heute nur wenige Freunde. Meist weit weg und nicht in der Nachbarschaft. Auch die russische „Schutzmacht“ ist hier im Süden noch präsent und ich nicht nur ich frage mich, wann sie gehen wollen, da sie beim letzten Konflikt mit ihrem aserbaidschanischen Nachbarn (Stichwort Bergkarabach) ihrem „Schützling“ nicht zur Hilfe kamen. Aber wir wissen ja, dass russische Truppen ungerne einmal gewonnenes Territorium wieder abgeben (z.B. Ukraine, Moldawien, Georgien). Damit kommen wir nach Georgien. Der Heimat Stalins und Schewadnadses. Das Land versucht(e), sich unabhängig und selbständig zu machen mit dem Ziel Europa. Große Teile der georgischen Kaukasusregion (Südossetien und Abschasien) sind von russischen Truppen oder Russland-freundlichen Milizen seit 2008 besetzt. Die aktuelle politische Entwicklung (Ergebnis der aktuellen, aber angezweifelten Parlamentswahlen) zeigt in eine Zukunft des Landes in der politischen Nähe zu Russland. Das ist von vielen (Mehrheit?) nicht gewollt und birgt ein immenses Konfliktrisiko.
Es fällt mir schwer, in diesen Ländern positive Entwicklungen im Sinne unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung zu sehen. Ob es für viele Wähler kein erstrebenswerter Zustand ist oder ob die Manipulation durch Machthaber zu dieser Orientierung führt, ist mir nicht klar.
Autokratie ist meines Erachtens jedenfalls nur für eine Minderheit gut.
Wie soll es nun weitergehen? Ich werde sicherlich die besten Bilder aufarbeiten und versuchen, sie auszustellen. Zudem würde ich mich freuen, wenn ich zu dieser Reise den ein oder anderen Vortrag halten könnte. Jedenfalls plane ich, 2025 wieder in die Region zu fahren, um meine Erfahrungen zu vertiefen. Der Leser wird es natürlich auf Instagram/Facebook/Polarsteps und anschließend hier auf der Homepage sehen können.